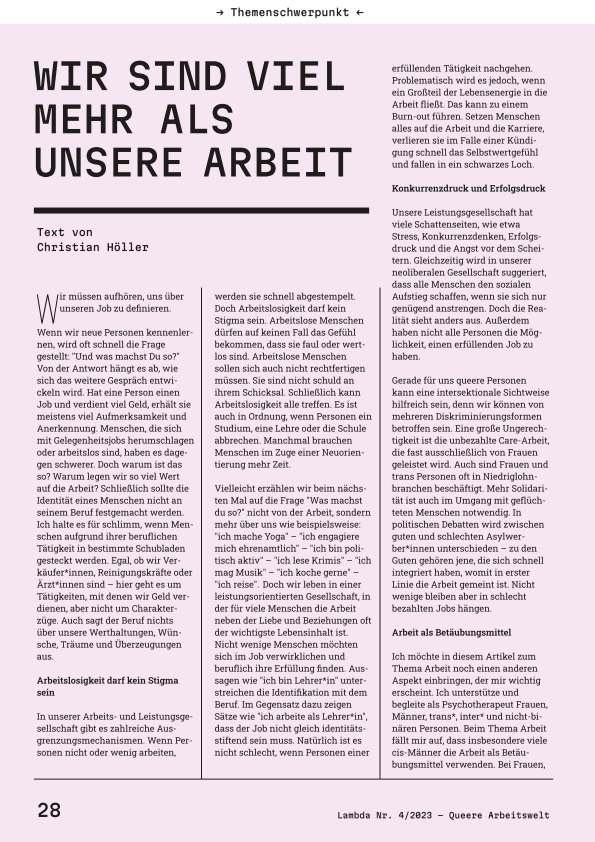Wir müssen aufhören, uns über unseren Job zu definieren.
Wenn wir neue Personen kennenlernen, wird oft schnell die Frage gestellt: „Und was machst Du so?“ Von der Antwort hängt es ab, wie sich das weitere Gespräch entwickeln wird. Hat eine Person einen Job und verdient viel Geld, erhält sie meistens viel Aufmerksamkeit und Anerkennung. Menschen, die sich mit Gelegenheitsjobs herumschlagen oder arbeitslos sind, haben es dagegen schwerer. Doch warum ist das so? Warum legen wir so viel Wert auf die Arbeit? Schließlich sollte die Identität eines Menschen nicht an seinem Beruf festgemacht werden. Ich halte es für schlimm, wenn Menschen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit in bestimmte Schubladen gesteckt werden. Egal, ob wir Verkäufer*innen, Reinigungskräfte oder Ärzt*innen sind – hier geht es um Tätigkeiten, mit denen wir Geld verdienen, aber nicht um Charakterzüge. Auch sagt der Beruf nichts über unsere Werthaltungen, Wünsche, Träume und Überzeugungen aus.
Arbeitslosigkeit darf kein Stigma sein
In unserer Arbeits- und Leistungsgesellschaft gibt es zahlreiche Ausgrenzungsmechanismen. Wenn Personen nicht oder wenig arbeiten, werden sie schnell abgestempelt. Doch Arbeitslosigkeit darf kein Stigma sein. Arbeitslose Menschen dürfen auf keinen Fall das Gefühl bekommen, dass sie faul oder wertlos sind. Arbeitslose Menschen sollen sich auch nicht rechtfertigen müssen. Sie sind nicht schuld an ihrem Schicksal. Schließlich kann Arbeitslosigkeit alle treffen. Es ist auch in Ordnung, wenn Personen ein Studium, eine Lehre oder die Schule abbrechen. Manchmal brauchen Menschen im Zuge einer Neuorientierung mehr Zeit.
Vielleicht erzählen wir beim nächsten Mal auf die Frage „Was machst du so?“ nicht von der Arbeit, sondern mehr über uns wie beispielsweise: „ich mache Yoga“ – „ich engagiere mich ehrenamtlich“ – „ich bin politisch aktiv“ – „ich lese Krimis“ – „ich mag Musik“ – „ich koche gerne“ – „ich reise“. Doch wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft, in der für viele Menschen die Arbeit neben der Liebe und Beziehungen oft der wichtigste Lebensinhalt ist. Nicht wenige Menschen möchten sich im Job verwirklichen und beruflich ihre Erfüllung finden. Aussagen wie „ich bin Lehrer*in“ unterstreichen die Identifikation mit dem Beruf. Im Gegensatz dazu zeigen Sätze wie „ich arbeite als Lehrer*in“, dass der Job nicht gleich identitätsstiftend sein muss. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn Personen einer erfüllenden Tätigkeit nachgehen. Problematisch wird es jedoch, wenn ein Großteil der Lebensenergie in die Arbeit fließt. Das kann zu einem Burn-out führen. Setzen Menschen alles auf die Arbeit und die Karriere, verlieren sie im Falle einer Kündigung schnell das Selbstwertgefühl und fallen in ein schwarzes Loch.
Konkurrenzdruck und Erfolgsdruck
Unsere Leistungsgesellschaft hat viele Schattenseiten, wie etwa Stress, Konkurrenzdenken, Erfolgsdruck und die Angst vor dem Scheitern. Gleichzeitig wird in unserer neoliberalen Gesellschaft suggeriert, dass alle Menschen den sozialen Aufstieg schaffen, wenn sie sich nur genügend anstrengen. Doch die Realität sieht anders aus. Außerdem haben nicht alle Personen die Möglichkeit, einen erfüllenden Job zu haben.
Gerade für uns queere Personen kann eine intersektionale Sichtweise hilfreich sein, denn wir können von mehreren Diskriminierungsformen betroffen sein. Eine große Ungerechtigkeit ist die unbezahlte Care-Arbeit, die fast ausschließlich von Frauen geleistet wird. Auch sind Frauen und trans Personen oft in Niedriglohnbranchen beschäftigt. Mehr Solidarität ist auch im Umgang mit geflüchteten Menschen notwendig. In politischen Debatten wird zwischen guten und schlechten Asylwerber*innen unterschieden – zu den Guten gehören jene, die sich schnell integriert haben, womit in erster Linie die Arbeit gemeint ist. Nicht wenige bleiben aber in schlecht bezahlten Jobs hängen.
Arbeit als Betäubungsmittel
Ich möchte in diesem Artikel zum Thema Arbeit noch einen anderen Aspekt einbringen, der mir wichtig erscheint. Ich unterstütze und begleite als Psychotherapeut Frauen, Männer, trans*, inter* und nicht-binären Personen. Beim Thema Arbeit fällt mir auf, dass insbesondere viele cis-Männer die Arbeit als Betäubungsmittel verwenden. Bei Frauen, trans, inter* und nicht-binären Personen kommt das selten vor. Dies hängt damit zusammen, dass wir leider immer noch in stark patriarchalen und binären Geschlechterstrukturen leben, wo sich cis-Männer viel über die Erwerbsarbeit definieren.
Nicht wenige cis-Männer verwenden die Arbeit als Betäubungsmittel, um nicht ins Fühlen zu kommen. Die bekannte Feministin bell hooks schreibt über das Thema Arbeit im Buch „Männer, Männlichkeit und Liebe“: „Viele Männer nutzen die Arbeit als einen Ort, an dem sie vor sich selbst, vor dem emotionalen Bewusstsein fliehen können, an dem sie sich selbst verlieren und aus einem Raum der emotionalen Taubheit heraus agieren können.“ Arbeitslosigkeit fühle sich für Männer emotional so bedrohlich an, „weil sie bedeutet, dass es Zeit zu füllen gäbe, und die meisten Männer in der patriarchalen Kultur wollen keine Zeit für sich haben“. Die Feministin bell hooks zitiert in ihrem Buch den US-Autor Victor Seidler, der schreibt: „Es gibt immer Dinge, die ich tun soll. Allein der Gedanke, mehr Zeit mit mir selbst zu verbringen, löst ein Gefühl der Panik und Angst aus.“ An einer anderen Stelle schreibt Seidler über Männer: „Wir geben uns nie wirklich die Chance, uns selbst besser kennenzulernen oder mehr Kontakt zu uns selbst zu entwickeln.“
Sich emotional öffnen
Schon alleine das Sprechen über Gefühle fällt manchen Männern schwer. Ihnen wurde oft im Kindheitsalter beigebracht, dass „richtige“ Männer nicht weinen dürfen, was mit der binären und patriarchalen Geschlechterordnung zusammenhängt. Dazu passt die Redewendung „ein Mann kennt keinen Schmerz“. Auch im Jugendalter werden Männer als „Weicheier“ oder als schwach abgestempelt, wenn sie sich verletzlich zeigen. Daher unterdrücken viele Männer ihre Gefühle. Sie versuchen, alles mit dem Verstand unter Kontrolle zu halten. Daher ist es notwendig, dass auch Männer schon im Kindheits- und Jugendalter lernen, sich emotional zu öffnen und nicht der binären und patriarchalen Geschlechterordnung zu folgen. Neben der Arbeit gibt es noch vielfältige Betäubungsmittel, um nicht fühlen zu müssen. In Österreich haben beispielsweise Männer nahezu doppelt so häufig einen problematischen Alkoholkonsum wie Frauen. Auch greifen Männer häufiger zu Drogen als Frauen. Dabei wäre die Beschäftigung mit den eigenen Gefühlen so wichtig, weil sie Hinweise auf die Bedürfnisse, Nöte, Wünsche und Träume geben. Wer keinen Kontakt zu den eigenen Gefühlen hat, ist wiederum anfällig für Manipulationsversuche von außen: Vor allem die Werbung und soziale Medien gaukeln uns vor, was wir angeblich brauchen.
In der psychotherapeutischen Arbeit geht es genau darum: Zugänge zu sich selbst und zu den eigenen Gefühlen zu bekommen. Doch das fällt eben cis-Männern, die in der patriarchalen und binären Geschlechterordnung verankert sind, deutlich schwerer als Frauen. Von Männern höre ich immer wieder, dass sie nicht die Kontrolle abgeben möchten. Doch es ist nicht das Ziel, nur noch auf die Gefühle zu hören und den Verstand komplett auszuschalten, sondern es geht darum, die Gefühle und den Verstand in Einklang zu bringen. Wer beispielsweise Angst hat, braucht auch den Verstand, um eine potenzielle Gefahr möglichst richtig einschätzen zu können. Oft schalten Menschen ihre Gefühle ab, wenn sie in der Vergangenheit ein Trauma erlebt haben. Doch letztendlich kostet es zu viel Kraft, ständig die eigenen Gefühle zu unterdrücken. Es ist befreiend, sich mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen. Ich wünsche mir eine Welt, in der die binäre und patriarchale Geschlechterordnung abgeschafft ist. Dafür ist es notwendig, dass vor allem cis-Männer neue Zugänge zum Job und zur Karriere finden und sich außerdem mehr mit sich selbst und den eigenen Gefühlen auseinandersetzen.