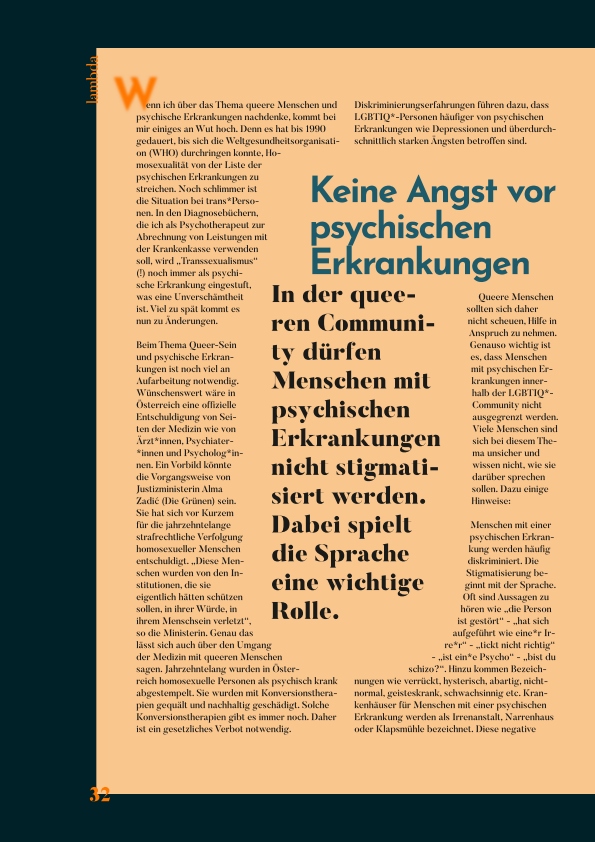In der queeren Community dürfen Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht stigmatisiert werden. Dabei spielt die Sprache eine wichtige Rolle.
Wenn ich über das Thema queere Menschen und psychische Erkrankungen nachdenke, kommt bei mir einiges an Wut hoch. Denn es hat bis 1990 gedauert, bis sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchringen konnte, Homosexualität von der Liste der psychischen Erkrankungen zu streichen. Noch schlimmer ist die Situation bei trans*Personen. In den Diagnosebüchern, die ich als Psychotherapeut zur Abrechnung von Leistungen mit der Krankenkasse verwenden soll, wird „Transsexualismus“ (!) noch immer als psychische Erkrankung eingestuft, was eine Unverschämtheit ist. Viel zu spät kommt es nun zu Änderungen.
Beim Thema Queer-Sein und psychische Erkrankungen ist noch viel an Aufarbeitung notwendig. Wünschenswert wäre in Österreich eine offizielle Entschuldigung von Seiten der Medizin wie von Ärzt*innen, Psychiater*innen und Psycholog*innen. Ein Vorbild könnte die Vorgangsweise von Justizministerin Alma Zadić (Die Grünen) sein. Sie hat sich vor Kurzem für die jahrzehntelange strafrechtliche Verfolgung homosexueller Menschen entschuldigt. „Diese Menschen wurden von den Institutionen, die sie eigentlich hätten schützen sollen, in ihrer Würde, in ihrem Menschsein verletzt“, so die Ministerin. Genau das lässt sich auch über den Umgang der Medizin mit queeren Menschen sagen. Jahrzehntelang wurden in Österreich homosexuelle Personen als psychisch krank abgestempelt. Sie wurden mit Konversionstherapien gequält und nachhaltig geschädigt. Solche Konversionstherapien gibt es immer noch. Daher ist ein gesetzliches Verbot notwendig.
Diskriminierungserfahrungen führen dazu, dass LGBTIQ*-Personen häufiger von psychischen Erkrankungen wie Depressionen und überdurchschnittlich starken Ängsten betroffen sind.
Queere Menschen sollten sich daher nicht scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Genauso wichtig ist es, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen innerhalb der LGBTIQ*-Community nicht ausgegrenzt werden. Viele Menschen sind sich bei diesem Thema unsicher und wissen nicht, wie sie darüber sprechen sollen. Dazu einige Hinweise:
Menschen mit einer psychischen Erkrankung werden häufig diskriminiert. Die Stigmatisierung beginnt mit der Sprache. Oft sind Aussagen zu hören wie „die Person ist gestört“ – „hat sich aufgeführt wie eine*r Irre*r“ – „tickt nicht richtig“ – „ist ein*e Psycho“ – „bist du schizo?“. Hinzu kommen Bezeichnungen wie verrückt, hysterisch, abartig, nicht-normal, geisteskrank, schwachsinnig etc. Krankenhäuser für Menschen mit einer psychischen Erkrankung werden als Irrenanstalt, Narrenhaus oder Klapsmühle bezeichnet. Diese negative Sprache führt dazu, dass sich betroffene Menschen zurückziehen und sich für die psychische Erkrankung schämen. Doch dazu besteht kein Grund.
In der Fachwelt hat sich durchgesetzt, nicht von „psychisch Erkrankten“, von „Depressiven“, von „Schizophrenen“ oder von „Manischen“ zu sprechen. Denn hier werden Personen einseitig und ausschließlich auf die psychische Erkrankung reduziert. Viel besser ist die Formulierung „Menschen mit einer psychischen Erkrankung“ oder „Menschen mit einer Depression“. Doch besser ist es, wenn wir von „Menschen mit einer depressiven Episode“ oder „Menschen mit einer manischen Episode“ sprechen. Damit wird deutlich, dass Menschen nicht nur depressive Episoden, sondern auch gesunde Phasen haben.
Bei psychischen Erkrankungen existieren oft falsche Vorstellungen: die Personen sind selbst schuld – sollen sich nicht so anstellen – sollen sich mehr zusammenreißen – sind zu schwach – es fehlt an Willenskraft – haben eine falsche Lebensführung – nutzen das Sozialsystem aus – sind faul oder Simulant*innen. Solche Behauptungen sind nachweislich falsch. Tatsächlich ist es meistens so, dass sich Menschen die Krankheitssymptome lange Zeit nicht eingestehen. Sie versuchen, die Fassade aufrecht zu erhalten und holen sich zu spät Hilfe. Doch je früher sie Hilfe annehmen, umso besser kann ihnen geholfen werden. Die Vorurteile können dazu führen, dass sich die betroffenen Menschen zurückziehen. Viele haben Angst vor negativen Reaktionen und wollen nicht, dass andere Person (wie in der Familie oder in der Arbeit) von der Erkrankung erfahren. Die Geheimhaltung und Tabuisierung sorgt für zusätzlichen Stress.
Viele psychische Erkrankungen sind gut behandelbar. Der Satz „einmal krank – immer krank“ stimmt nicht. Genauso falsch ist die Annahme, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung aggressiver sind. Die Krankheitssymptome treten unterschiedlich auf, auch der Verlauf der Erkrankung ist individuell. Viele Personen sind trotz der Erkrankung berufstätig oder studieren. Genauso individuell sind die Behandlungsmöglichkeiten. Manche Personen gehen in Psychotherapie, manche nehmen Medikamente, gehen ins Krankenhaus oder beantragen einen Reha-Aufenthalt. Je mehr wir über psychische Erkrankungen wissen, umso leichter können wir damit umgehen.
Wenn wir über psychische Erkrankungen sprechen, sollten wir diese nicht schockierend oder negativ darstellen, denn es handelt sich hier um Krankheitsphänomene, die in unserer Gesellschaft häufig vorkommen. Auch soll uns klar sein, dass jeder Mensch psychisch krank werden kann. Für die Personen ist es meistens eine Erleichterung, wenn sie mit Freund*innen darüber sprechen können. Dabei ist jede diskriminierende Bezeichnung wie „Störung“ oder „war in der Klapsmühle“ zu vermeiden. Nicht empfehlenswert ist beispielsweise die Frage: „Wann hast du gemerkt, dass bei dir etwas nicht stimmt?“. Viel besser ist die Formulierung: „Wann sind bei dir die ersten Symptome aufgetreten?“. Wenn wir nicht wissen, wie wir helfen können, dann ist es ratsam, die betroffenen Personen einfach zu fragen. Je nach Situation und Verlauf der Erkrankung kann die Unterstützung unterschiedlich sein. Oft ist es schon hilfreich, empathisch zuzuhören. Ein anderes Mal wollen sich die Menschen zurückziehen, weil ihnen gerade alles zu viel ist. Dann sollen wir diesen Wunsch respektieren. Nicht hilfreich sind Standardsätze wie „das wird schon wieder“, „Kopf hoch“ oder „reiß dich zusammen“. Denn damit fühlen sich die Personen nicht ernst genommen. Ratsam ist es außerdem, die Personen nicht nur auf die Erkrankung zu reduzieren, sondern mit ihnen auch über andere Themen zu sprechen wie beispielsweise über Hobbys, Interessen, Freund*innen.
Wer sich Hilfe holt, sollte sich beim Erstgespräch über die Ansichten der Mediziner*innen und Psychotherapeut*innen zur sexuellen Vielfalt erkundigen. Ich höre immer wieder, dass Menschen wegen einer Depression zu Psychotherapeut*innen gegangen sind und dann später die Therapie abgebrochen haben, weil es den Therapeut*innen an der notwendigen Offenheit bei sexuellen Themen und vielfältigen Lebensstilen gefehlt hat.