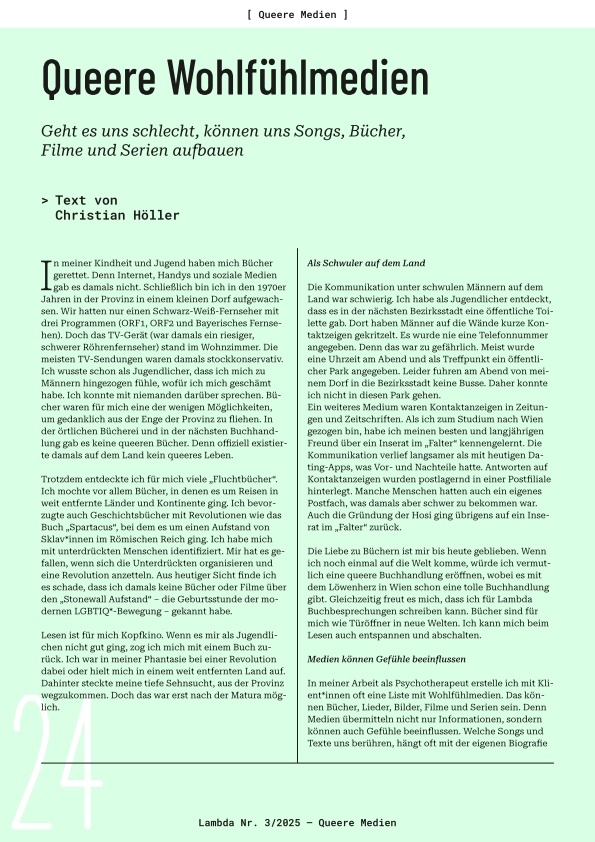Geht es uns schlecht, können uns Songs, Bücher, Filme und Serien aufbauen
In meiner Kindheit und Jugend haben mich Bücher gerettet. Denn Internet, Handys und soziale Medien gab es damals nicht. Schließlich bin ich in den 1970er Jahren in der Provinz in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Wir hatten nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher mit drei Programmen (ORF1, ORF2 und Bayerisches Fernsehen). Doch das TV-Gerät (war damals ein riesiger, schwerer Röhrenfernseher) stand im Wohnzimmer. Die meisten TV-Sendungen waren damals stockkonservativ. Ich wusste schon als Jugendlicher, dass ich mich zu Männern hingezogen fühle, wofür ich mich geschämt habe. Ich konnte mit niemanden darüber sprechen. Bücher waren für mich eine der wenigen Möglichkeiten, um gedanklich aus der Enge der Provinz zu fliehen. In der örtlichen Bücherei und in der nächsten Buchhandlung gab es keine queeren Bücher. Denn offiziell existierte damals auf dem Land kein queeres Leben.
Trotzdem entdeckte ich für mich viele „Fluchtbücher“. Ich mochte vor allem Bücher, in denen es um Reisen in weit entfernte Länder und Kontinente ging. Ich bevorzugte auch Geschichtsbücher mit Revolutionen wie das Buch „Spartacus“, bei dem es um einen Aufstand von Sklav*innen im Römischen Reich ging. Ich habe mich mit unterdrückten Menschen identifiziert. Mir hat es gefallen, wenn sich die Unterdrückten organisieren und eine Revolution anzetteln. Aus heutiger Sicht finde ich es schade, dass ich damals keine Bücher oder Filme über den „Stonewall Aufstand“ – die Geburtsstunde der modernen LGBTIQ*-Bewegung – gekannt habe.
Lesen ist für mich Kopfkino. Wenn es mir als Jugendlichen nicht gut ging, zog ich mich mit einem Buch zurück. Ich war in meiner Phantasie bei einer Revolution dabei oder hielt mich in einem weit entfernten Land auf. Dahinter steckte meine tiefe Sehnsucht, aus der Provinz wegzukommen. Doch das war erst nach der Matura möglich.
Als Schwuler auf dem Land
Die Kommunikation unter schwulen Männern auf dem Land war schwierig. Ich habe als Jugendlicher entdeckt, dass es in der nächsten Bezirksstadt eine öffentliche Toilette gab. Dort haben Männer auf die Wände kurze Kontaktzeigen gekritzelt. Es wurde nie eine Telefonnummer angegeben. Denn das war zu gefährlich. Meist wurde eine Uhrzeit am Abend und als Treffpunkt ein öffentlicher Park angegeben. Leider fuhren am Abend von meinem Dorf in die Bezirksstadt keine Busse. Daher konnte ich nicht in diesen Park gehen.
Ein weiteres Medium waren Kontaktanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften. Als ich zum Studium nach Wien gezogen bin, habe ich meinen besten und langjährigen Freund über ein Inserat im „Falter“ kennengelernt. Die Kommunikation verlief langsamer als mit heutigen Dating-Apps, was Vor- und Nachteile hatte. Antworten auf Kontaktanzeigen wurden postlagernd in einer Postfiliale hinterlegt. Manche Menschen hatten auch ein eigenes Postfach, was damals aber schwer zu bekommen war. Auch die Gründung der Hosi ging übrigens auf ein Inserat im „Falter“ zurück.
Die Liebe zu Büchern ist mir bis heute geblieben. Wenn ich noch einmal auf die Welt komme, würde ich vermutlich eine queere Buchhandlung eröffnen, wobei es mit dem Löwenherz in Wien schon eine tolle Buchhandlung gibt. Gleichzeitig freut es mich, dass ich für Lambda Buchbesprechungen schreiben kann. Bücher sind für mich wie Türöffner in neue Welten. Ich kann mich beim Lesen auch entspannen und abschalten.
Medien können Gefühle beeinflussen
In meiner Arbeit als Psychotherapeut erstelle ich mit Klient*innen oft eine Liste mit Wohlfühlmedien. Das können Bücher, Lieder, Bilder, Filme und Serien sein. Denn Medien übermitteln nicht nur Informationen, sondern können auch Gefühle beeinflussen. Welche Songs und Texte uns berühren, hängt oft mit der eigenen Biografie und vergangenen Erlebnissen zusammen. Musik kann beispielsweise trösten, aber auch negative Gefühle verstärken. Befindet sich eine Person in einer depressiven Stimmung und bevorzugt dann melancholische Musik, kann es sein, dass die Person ihr seelisches Tief aufrecht erhalten möchte. Dann kann es vielleicht helfen, die Gründe zu erforschen, warum die Person an diesem Zustand festhalten möchte. Medien wie Bücher, Filme und Musikstücke können auch beim „Mood Management“ (Stimmungs-Management) helfen. Oft kann es helfen, sich zu fragen, in welchem emotionalen Zustand befinde ich mich gerade und in welche Stimmung möchte ich kommen. Eine Person, die kurz vor dem Einschlafen zur Ruhe kommen will, sollte sich besser keine aufwühlende oder belastende TV-Doku ansehen, sondern vielleicht Entspannungsmusik hören. Oder wenn eine Person schlecht gelaunt ist, kann vielleicht ein spannender und unterhaltsamer Film die Stimmung heben. In Zeiten, in denen es einer Person nicht gut geht, kann ein individuell zusammengestellter Ressourcenkoffer mit Wohlfühlmedien helfen. Dort können sich Lieblings-Musik-CDs, ein Abo für einen Streaming-Dienst, Bücher, Fotoalben, bestimmte Gegenstände (wie ein Puzzle oder Malsachen), Sportkleidung, DVDs oder Blu-rays mit Filmen und TV-Serien befinden.
Hilfestellung bei der Identitätsfindung
Medien können auch Hilfestellungen bei der Identitätsbildung leisten. Sie können unser Verständnis für Geschlechterrollen wecken und die Identifikation mit bestimmten Gruppen ermöglichen. Heute gibt es zum Glück einige gute queere Wohlfühlfilme und Wohlfühlserien für LGBTIQ-Personen. Früher war das anders. Meine erste queere Wohlfühlserie war die kanadisch-US-amerikanische Fernsehserie „Queer as Folk“. Hier habe ich manches über queeres und schwules Leben gelernt. Die Serie war einst revolutionär. Erstmals wurde homosexuelles Leben in allen Facetten gezeigt. Mir hat die Serie gefallen, weil „Queer as Folk“ queeres Leben gefeiert hat. Es gibt dort tolle Charaktere, spannende Liebesgeschichten, wobei es nicht nur um Liebe und Sex, sondern vor allem um Freundschaften geht. Aus heutiger Sicht haben in der Serie wichtige Aspekte queeren Lebens gefehlt wie beispielsweise Personen of Color und trans* Personen. Eine weitere bahnbrechende Serie war „The L Word“, die das Leben einer Gruppe lesbischer, bisexueller und trans* Personen zeigte. Für graue und nebelige Herbst- und Wintertage empfehle ich queere Empowerment- und Wohlfühlserien wie „Pose“, „Stadtgeschichten“, „Sex Education“, „Heartstopper“, „Young Royals“, „Love, Victor“, „Smiley“. Als queere und behinderte Person mag ich die Serie „Ein besonderes Leben“ über einen schwulen Mann mit einer chronischen Behinderung. Sehenswert ist auch die kanadische Serie „Sort of“, bei der es um die Suche eines jungen Menschen nach der eigenen Identität geht. Im Mittelpunkt steht Sabi Mehboob (Bilal Baig), Kind pakistanisch-muslimischer Einwanderer in Kanada. Die Serie ist eine Mischung aus Coming-of-Age-Drama und Queer-Comedy. „Jeder Mensch verändert sich doch ständig und ist somit in Transition“, sagt eine Person zu Sabi. Das ist ein wunderbarer Satz, dem nichts hinzuzufügen ist.