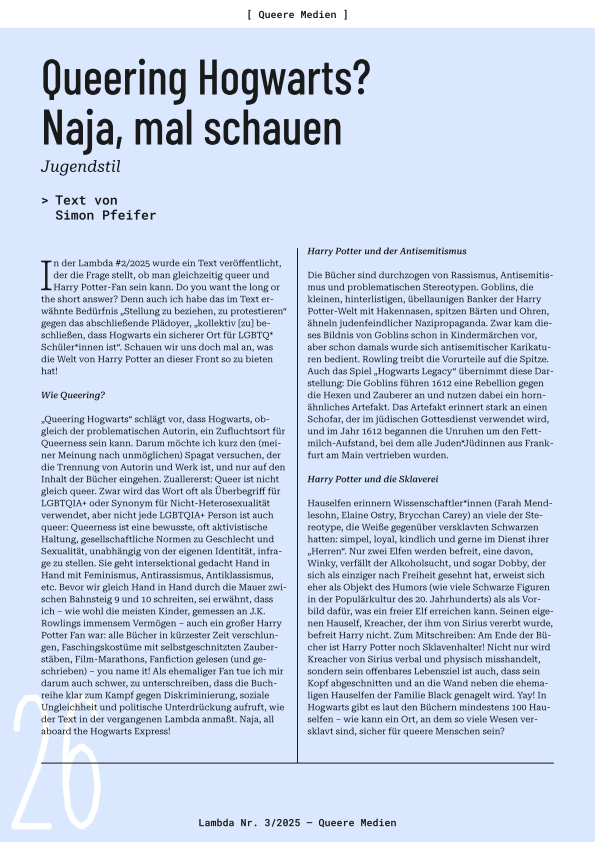In der Lambda #2/2025 wurde ein Text veröffentlicht, der die Frage stellt, ob man gleichzeitig queer und Harry Potter-Fan sein kann. Do you want the long or the short answer? Denn auch ich habe das im Text erwähnte Bedürfnis „Stellung zu beziehen, zu protestieren“ gegen das abschließende Plädoyer, „kollektiv [zu] beschließen, dass Hogwarts ein sicherer Ort für LGBTQ* Schüler*innen ist“. Schauen wir uns doch mal an, was die Welt von Harry Potter an dieser Front so zu bieten hat!
Wie Queering?
„Queering Hogwarts“ schlägt vor, dass Hogwarts, obgleich der problematischen Autorin, ein Zufluchtsort für Queerness sein kann. Darum möchte ich kurz den (meiner Meinung nach unmöglichen) Spagat versuchen, der die Trennung von Autorin und Werk ist, und nur auf den Inhalt der Bücher eingehen. Zuallererst: Queer ist nicht gleich queer. Zwar wird das Wort oft als Überbegriff für LGBTQIA+ oder Synonym für Nicht-Heterosexualität verwendet, aber nicht jede LGBTQIA+ Person ist auch queer: Queerness ist eine bewusste, oft aktivistische Haltung, gesellschaftliche Normen zu Geschlecht und Sexualität, unabhängig von der eigenen Identität, infrage zu stellen. Sie geht intersektional gedacht Hand in Hand mit Feminismus, Antirassismus, Antiklassismus, etc. Bevor wir gleich Hand in Hand durch die Mauer zwischen Bahnsteig 9 und 10 schreiten, sei erwähnt, dass ich – wie wohl die meisten Kinder, gemessen an J.K. Rowlings immensem Vermögen – auch ein großer Harry Potter Fan war: alle Bücher in kürzester Zeit verschlungen, Faschingskostüme mit selbstgeschnitzten Zauberstäben, Film-Marathons, Fanfiction gelesen (und geschrieben) – you name it! Als ehemaliger Fan tue ich mir darum auch schwer, zu unterschreiben, dass die Buchreihe klar zum Kampf gegen Diskriminierung, soziale Ungleichheit und politische Unterdrückung aufruft, wie der Text in der vergangenen Lambda anmaßt. Naja, all aboard the Hogwarts Express!
Harry Potter und der Antisemitismus
Die Bücher sind durchzogen von Rassismus, Antisemitismus und problematischen Stereotypen. Goblins, die kleinen, hinterlistigen, übellaunigen Banker der Harry Potter-Welt mit Hakennasen, spitzen Bärten und Ohren, ähneln judenfeindlicher Nazipropaganda. Zwar kam dieses Bildnis von Goblins schon in Kindermärchen vor, aber schon damals wurde sich antisemitischer Karikaturen bedient. Rowling treibt die Vorurteile auf die Spitze. Auch das Spiel „Hogwarts Legacy“ übernimmt diese Darstellung: Die Goblins führen 1612 eine Rebellion gegen die Hexen und Zauberer an und nutzen dabei ein hornähnliches Artefakt. Das Artefakt erinnert stark an einen Schofar, der im jüdischen Gottesdienst verwendet wird, und im Jahr 1612 begannen die Unruhen um den Fettmilch-Aufstand, bei dem alle Juden*Jüdinnen aus Frankfurt am Main vertrieben wurden.
Harry Potter und die Sklaverei
Hauselfen erinnern Wissenschaftler*innen (Farah Mendlesohn, Elaine Ostry, Brycchan Carey) an viele der Stereotype, die Weiße gegenüber versklavten Schwarzen hatten: simpel, loyal, kindlich und gerne im Dienst ihrer „Herren“. Nur zwei Elfen werden befreit, eine davon, Winky, verfällt der Alkoholsucht, und sogar Dobby, der sich als einziger nach Freiheit gesehnt hat, erweist sich eher als Objekt des Humors (wie viele Schwarze Figuren in der Populärkultur des 20. Jahrhunderts) als als Vorbild dafür, was ein freier Elf erreichen kann. Seinen eigenen Hauself, Kreacher, der ihm von Sirius vererbt wurde, befreit Harry nicht. Zum Mitschreiben: Am Ende der Bücher ist Harry Potter noch Sklavenhalter! Nicht nur wird Kreacher von Sirius verbal und physisch misshandelt, sondern sein offenbares Lebensziel ist auch, dass sein Kopf abgeschnitten und an die Wand neben die ehemaligen Hauselfen der Familie Black genagelt wird. Yay! In Hogwarts gibt es laut den Büchern mindestens 100 Hauselfen – wie kann ein Ort, an dem so viele Wesen versklavt sind, sicher für queere Menschen sein?
Harry Potter und die eindimensionalen Karikaturen
Die Antagonist*innen in Harry Potter werden häufig durch Unattraktivität oder Übergewicht charakterisiert: Umbridge sieht aus wie eine Kröte und Peter Pettigrew auch als Mensch rattenähnlich, Dudley, Vernon und Marge Dursley sind alle dick – und Marge hat zusätzlich noch einen Bart – und Rita Skeeter, die Frau, die Kindern nachspioniert, wird als unansehnlich beschrieben, weil sie so maskulin ist. Ihre Körper dienen dabei nicht nur der Beschreibung, sondern unterstreichen aktiv ihre moralische Minderwertigkeit. Fettsein wird als etwas Lächerliches, Abstoßendes oder Bedrohliches inszeniert – eine visuelle Abkürzung, um Figuren unsympathisch wirken zu lassen.
Um die Nebencharaktere steht es nicht viel besser – sie haben oft klischeehafte Namen und Eigenschaften: einer der zwei Schwarzen Männer heißt Kingsley Shacklebolt („Shackle“ dt. „Kette“, deutet auf Versklavung von Schwarzen) und der andere, Dean Thomas, wuchs ohne Vater auf. Die eine Asiatin, Cho Chang, trägt zwei chinesische Nachnamen, muss dünn sein und viel lernen, und der einzige jüdische Zauberer heißt natürlich Anthony Goldstein und ist – ähnlich Dumbledores Homosexualität – auch erst nach der Veröffentlichung der Bücher in einem Tweet entstanden. Solche eindimensionalen Darstellungen befeuern diskriminierende Narrative. Magische LGBTQIA+ Personen hätten womöglich Carabina Lickwell und Felatius Flamboyant geheißen.
Harry Potter und der Status Quo
Nach der Schule wird Harry Auror, ein magischer Polizist – also das de facto Gegenteil des Kampfes gegen Diskriminierung, soziale Ungleichheit und politische Unterdrückung – dessen Aufgabe es ist, die Ordnung aufrecht zu erhalten, egal wie rassistisch oder klassistisch diese ist. Dass sich viele LGBTQIA+ Personen in den Harry Potter Büchern wiedergefunden haben, schreibe ich dem zu, dass sich Harry – wie wohl viele dieser Leser*innen – als Außenseiter in seiner eigenen Familie fühlt und die Geschichte ihn zu etwas Besonderem – The Chosen One – macht. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Harry Potter Reihe. Ask your local librarian: Es gibt unzählige Bücher, die ohne problematische Darstellungen auskommen und einen Rückzugsort für queere Leser*innen bieten – sowohl inhaltlich als auch in der realen Welt mit dem Wissen, dass die Autor*innen keine transfeindlichen Interessensgruppen finanzieren. Ich werde nicht näher darauf eingehen, dass J.K. Rowling die wahrscheinlich einflussreichste TER„F“ (Trans Exclusionary Radical „Feminist“) der Welt ist und jeder Cent, der in ihre Taschen fließt, zur materiellen Diskriminierung von trans* Personen weltweit beiträgt und allein deshalb Queerness und Harry Potter Fandom meiner Meinung nach heute unvereinbar sind. Allen, die sich näher mit dem Thema auseinandersetzen wollen, empfehle ich die Youtube Filme „J.K. Rowling“ und „The Witch Trials of J.K. Rowling“ von Contrapoints, sowie den Song „GERM“ von Kate Nash.
Kommentar von Chiara Beier
Ich habe Simon Pfeifers Text gelesen und kann die Kommentare nachvollziehen, die Kritikpunkte sind gerechtfertigt. Meiner Meinung nach können beide Ansichten, in diesem und meinem Artikel, gleichzeitig wahr sein. Damit soll J. K. Rowling auf keinen Fall in Schutz genommen oder ihre Aktionen irgendwie gerechtfertigt werden. Trotzdem waren für mich in den Büchern Offenheit und Akzeptanz zentrale Werte; das habe ich aus ihnen für mich mitgenommen. Aus heutiger Perspektive kann man das natürlich kritischer betrachten und sehen, ob das noch das ist, was man davon mitnimmt – vor allem, wenn es bessere Alternativen gibt.
■ Jugendstil

Der Jugendstil begann mit den Lambda Nachrichten #1/2014. Schon damals und auch seitdem ist sie ein Sprachrohr unserer Jugendgruppe, inzwischen Queer Youth Vienna (QYVIE).