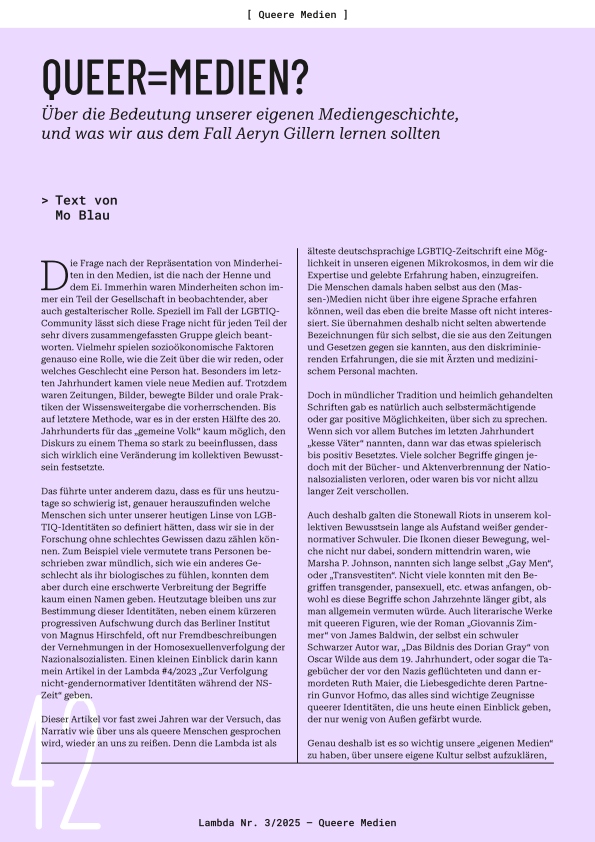Über die Bedeutung unserer eigenen Mediengeschichte, und was wir aus dem Fall Aeryn Gillern lernen sollten
Die Frage nach der Repräsentation von Minderheiten in den Medien, ist die nach der Henne und dem Ei. Immerhin waren Minderheiten schon immer ein Teil der Gesellschaft in beobachtender, aber auch gestalterischer Rolle. Speziell im Fall der LGBTIQ-Community lässt sich diese Frage nicht für jeden Teil der sehr divers zusammengefassten Gruppe gleich beantworten. Vielmehr spielen sozioökonomische Faktoren genauso eine Rolle, wie die Zeit über die wir reden, oder welches Geschlecht eine Person hat. Besonders im letzten Jahrhundert kamen viele neue Medien auf. Trotzdem waren Zeitungen, Bilder, bewegte Bilder und orale Praktiken der Wissensweitergabe die vorherrschenden. Bis auf letztere Methode, war es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für das „gemeine Volk“ kaum möglich, den Diskurs zu einem Thema so stark zu beeinflussen, dass sich wirklich eine Veränderung im kollektiven Bewusstsein festsetzte.
Das führte unter anderem dazu, dass es für uns heutzutage so schwierig ist, genauer herauszufinden welche Menschen sich unter unserer heutigen Linse von LGBTIQ-Identitäten so definiert hätten, dass wir sie in der Forschung ohne schlechtes Gewissen dazu zählen können. Zum Beispiel viele vermutete trans Personen beschrieben zwar mündlich, sich wie ein anderes Geschlecht als ihr biologisches zu fühlen, konnten dem aber durch eine erschwerte Verbreitung der Begriffe kaum einen Namen geben. Heutzutage bleiben uns zur Bestimmung dieser Identitäten, neben einem kürzeren progressiven Aufschwung durch das Berliner Institut von Magnus Hirschfeld, oft nur Fremdbeschreibungen der Vernehmungen in der Homosexuellenverfolgung der Nazionalsozialisten. Einen kleinen Einblick darin kann mein Artikel in der Lambda #4/2023 „Zur Verfolgung nicht-gendernormativer Identitäten während der NS-Zeit“ geben.
Dieser Artikel vor fast zwei Jahren war der Versuch, das Narrativ wie über uns als queere Menschen gesprochen wird, wieder an uns zu reißen. Denn die Lambda ist als älteste deutschsprachige LGBTIQ-Zeitschrift eine Möglichkeit in unseren eigenen Mikrokosmos, in dem wir die Expertise und gelebte Erfahrung haben, einzugreifen. Die Menschen damals haben selbst aus den (Massen-)Medien nicht über ihre eigene Sprache erfahren können, weil das eben die breite Masse oft nicht interessiert. Sie übernahmen deshalb nicht selten abwertende Bezeichnungen für sich selbst, die sie aus den Zeitungen und Gesetzen gegen sie kannten, aus den diskriminierenden Erfahrungen, die sie mit Ärzten und medizinischem Personal machten.
Doch in mündlicher Tradition und heimlich gehandelten Schriften gab es natürlich auch selbstermächtigende oder gar positive Möglichkeiten, über sich zu sprechen. Wenn sich vor allem Butches im letzten Jahrhundert „kesse Väter“ nannten, dann war das etwas spielerisch bis positiv Besetztes. Viele solcher Begriffe gingen jedoch mit der Bücher- und Aktenverbrennung der Nationalsozialisten verloren, oder waren bis vor nicht allzu langer Zeit verschollen.
Auch deshalb galten die Stonewall Riots in unserem kollektiven Bewusstsein lange als Aufstand weißer gender-normativer Schwuler. Die Ikonen dieser Bewegung, welche nicht nur dabei, sondern mittendrin waren, wie Marsha P. Johnson, nannten sich lange selbst „Gay Men“, oder „Transvestiten“. Nicht viele konnten mit den Begriffen transgender, pansexuell, etc. etwas anfangen, obwohl es diese Begriffe schon Jahrzehnte länger gibt, als man allgemein vermuten würde. Auch literarische Werke mit queeren Figuren, wie der Roman „Giovannis Zimmer“ von James Baldwin, der selbst ein schwuler Schwarzer Autor war, „Das Bildnis des Dorian Gray“ von Oscar Wilde aus dem 19. Jahrhundert, oder sogar die Tagebücher der vor den Nazis geflüchteten und dann ermordeten Ruth Maier, die Liebesgedichte deren Partnerin Gunvor Hofmo, das alles sind wichtige Zeugnisse queerer Identitäten, die uns heute einen Einblick geben, der nur wenig von Außen gefärbt wurde.
Genau deshalb ist es so wichtig unsere „eigenen Medien“ zu haben, über unsere eigene Kultur selbst aufzuklären, sie auszuleben, zu zeigen. Bilder der Regenbogenparade, aus dem Gugg, von einer queeren Party oder beispielsweise das Buchcover eines Romans mit schwulem Protagonisten sind nicht umsonst feste Bestandteile der meisten queeren Medien wie queere Magazine und Lifestyle-Blogs. Wir zeigen die Minderheiten in der Gesellschaft, also die LGBTIQ-Leben, und innerhalb dieser Minderheit, weitere Minderheiten aus unserer Community, wie die Lebensrealitäten von intergeschlechtlichen Menschen, oder eine Gruppe die entgegen ihrer tatsächlichen Gruppengröße in der Community wie eine Minderheit, zumindest stiefmütterlich, behandelt wird: die der Bisexuellen.
Heutzutage könnte man meinen, die Kommunikation sei durch Soziale Medien wie TikTok, Instagram und Co demokratisierter als noch vor hundert Jahren. In gewisser Weise ist dem wohl auch grundsätzlich wenig entgegenzusetzen, denn wir haben mit den schier endlosen Möglichkeiten des Internets und neuer Werkzeuge wie AI-Tools mehr Informationen zur Verfügung als je zuvor. Jedoch darf nicht übersehen werden, dass letztlich jede Publikation, jedes Medium, egal ob aus unserer Community heraus oder von außen über uns, gefärbt ist. Auch wenn es so wirken kann, als ob Google, Chat GPT, Wikipedia, ein Lexikon oder ein Zeitungsbeitrag, ein Polizeibericht die ungeschönte, neutrale Wahrheit darbieten, alles ist gefärbt. Von eigenen Erfahrungen, eigenen Ängsten. Davor sollten wir keine Angst haben. Deshalb sage ich Menschen, die mehr über die LGBTIQ-Community erfahren wollen, auch nicht gerne „schau bitte selbst nach“, wie von einigen erklärungsmüden Queers gerne verlangt wird. Ich rate eher „schau dir doch mal diese Lambda zum Überthema, das dich interessiert, an! Lass dir von jemandem im Gugg über das und das etwas erzählen! Da gibt es einen Dokumentarfilm, ein Liebesdrama, ein Comedy-Set, ich lade dich ein, es dir anzusehen!“
Denn „unsere Medien“ bilden die Realität von uns als Community logischerweise viel eher so ab, wie wir sie auch wirklich erleben. Da wird mal ein Streit über das Thema XY in der Lambda über mehrere Ausgaben hinweg ausgetragen, oder ich sehe einen Film über die Türkis Rosa Lila Villa aus den 80ern, wo sich die Schwulen darüber aufregen, dass die Lesben im Wohnverein nur arbeiten wollen, und die Lesben darüber, dass die Schwulen nur feiern und mit anderen Männern tanzen wollen, statt Demoplakate zu basteln. Diese scheinbar banalen Dokumentationen gilt es auch gerade für die Nachwelt festzuhalten, und sei es nur um sich versichern zu können, dass sich in mehreren Jahrzehnten bei uns manchmal scheinbar gar nicht so viel verändert.
Das bedeutet gleichzeitig, es ist wichtig auszuwählen was wichtig genug, oder zu unwichtig ist, um es in unseren Medien abzubilden. Ein Fall, der mir dabei ganz besonders ins Auge sticht, ist der Vermisstenfall von Aeryn Gillern. Ein US-Amerikanischer Staatsbürger und seinerzeit der erste Mister Gay Austria, der 2007 in bzw. vor der geschichtsträchtigen Herrensauna Kaiserbründl verschwand. Ich hatte davon nur erfahren, weil mir im Gugg von einem schwulen Freund davon erzählt wurde. Bei meiner Recherche darüber, von Büchern zu dem Thema über das Nachlesen von parlamentarischen Anfragen über Podcasts bis hin zu Hintergrundgesprächen, ist mir eines aufgefallen: Scheinbar berichteten zum Zeitpunkt des Verschwindens überwiegend bis ausschließlich nicht-Community Medien darüber, nicht aber unsere eigenen. Nach einer vorverurteilenden Einordnung der lokalen Ermittlungsbehörden wurde der Fall zu schnell und ohne handfeste Beweise als Suizid eingestuft, weshalb er vorerst zu den Akten gelegt wurde. Logischerweise war dadurch und einem allgemein angespannten Verhältnis unserer Community zur Polizei, besonders 2007, das Vertrauen, sich bei den Behörden mit Hinweisen zu melden, nicht sehr groß. Als Aeryn Gillern Mister Gay Austria wurde, berichtete beispielsweise das Magazin XTRA! mit einer Titelseite darüber. Als er nun aber vermisst wurde, gab es, trotz des Wunsches dafür durch seine angereiste Mutter, keine weitere Berichterstattung in ähnlichem Ausmaß. Selbst wenn der Vermisste in der Community durchaus gemischte Gefühle vor seinem Verschwinden hervorrief, müssen wir uns nun leider alle die Frage stellen: Hätte er gefunden werden können, wenn in unseren Medien mehr über ihn berichtet worden wäre und sich dadurch vielleicht Zeug*innen mit Hinweisen gemeldet hätten?
Auch das sollte nämlich eine Aufgabe „unserer Medien“ sein. Denn egal welches Verhältnis man zu einer Person aus unserer Community hat, sobald jemandem von uns etwas passiert, geschieht es uns allen. Persönliche Tragödien haben als Gemeinschaft eine kollektive Tragweite.
Unterhaltung kann, sollte jedoch wahrlich nicht die einzige Aufgabe der Medien sein, die wir aus uns heraus, überwiegend für uns gegenseitig, produzieren.
Hinweise & Anmerkungen zum Verschwinden von Aeryn Gillern bitte an [email protected]