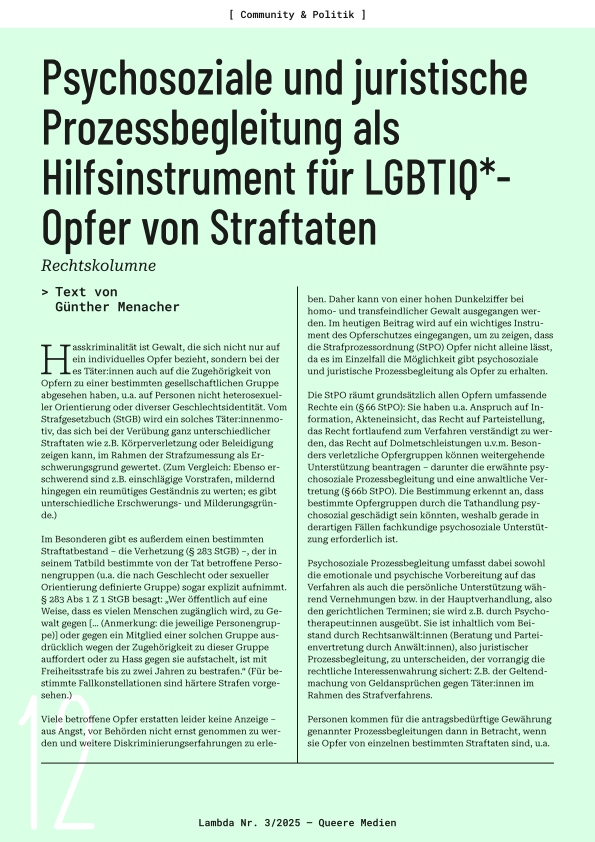Hasskriminalität ist Gewalt, die sich nicht nur auf ein individuelles Opfer bezieht, sondern bei der es Täter:innen auch auf die Zugehörigkeit von Opfern zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe abgesehen haben, u.a. auf Personen nicht heterosexueller Orientierung oder diverser Geschlechtsidentität. Vom Strafgesetzbuch (StGB) wird ein solches Täter:innenmotiv, das sich bei der Verübung ganz unterschiedlicher Straftaten wie z.B. Körperverletzung oder Beleidigung zeigen kann, im Rahmen der Strafzumessung als Erschwerungsgrund gewertet. (Zum Vergleich: Ebenso erschwerend sind z.B. einschlägige Vorstrafen, mildernd hingegen ein reumütiges Geständnis zu werten; es gibt unterschiedliche Erschwerungs- und Milderungsgründe.)
Im Besonderen gibt es außerdem einen bestimmten Straftatbestand – die Verhetzung (§ 283 StGB) –, der in seinem Tatbild bestimmte von der Tat betroffene Personengruppen (u.a. die nach Geschlecht oder sexueller Orientierung definierte Gruppe) sogar explizit aufnimmt. § 283 Abs 1 Z 1 StGB besagt: „Wer öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, zu Gewalt gegen [… (Anmerkung: die jeweilige Personengruppe)] oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auffordert oder zu Hass gegen sie aufstachelt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.“ (Für bestimmte Fallkonstellationen sind härtere Strafen vorgesehen.)
Viele betroffene Opfer erstatten leider keine Anzeige – aus Angst, vor Behörden nicht ernst genommen zu werden und weitere Diskriminierungserfahrungen zu erleben. Daher kann von einer hohen Dunkelziffer bei homo- und transfeindlicher Gewalt ausgegangen werden. Im heutigen Beitrag wird auf ein wichtiges Instrument des Opferschutzes eingegangen, um zu zeigen, dass die Strafprozessordnung (StPO) Opfer nicht alleine lässt, da es im Einzelfall die Möglichkeit gibt psychosoziale und juristische Prozessbegleitung als Opfer zu erhalten.
Die StPO räumt grundsätzlich allen Opfern umfassende Rechte ein (§ 66 StPO): Sie haben u.a. Anspruch auf Information, Akteneinsicht, das Recht auf Parteistellung, das Recht fortlaufend zum Verfahren verständigt zu werden, das Recht auf Dolmetschleistungen u.v.m. Besonders verletzliche Opfergruppen können weitergehende Unterstützung beantragen – darunter die erwähnte psychosoziale Prozessbegleitung und eine anwaltliche Vertretung (§ 66b StPO). Die Bestimmung erkennt an, dass bestimmte Opfergruppen durch die Tathandlung psychosozial geschädigt sein könnten, weshalb gerade in derartigen Fällen fachkundige psychosoziale Unterstützung erforderlich ist.
Psychosoziale Prozessbegleitung umfasst dabei sowohl die emotionale und psychische Vorbereitung auf das Verfahren als auch die persönliche Unterstützung während Vernehmungen bzw. in der Hauptverhandlung, also den gerichtlichen Terminen; sie wird z.B. durch Psychotherapeut:innen ausgeübt. Sie ist inhaltlich vom Beistand durch Rechtsanwält:innen (Beratung und Parteienvertretung durch Anwält:innen), also juristischer Prozessbegleitung, zu unterscheiden, der vorrangig die rechtliche Interessenwahrung sichert: Z.B. der Geltendmachung von Geldansprüchen gegen Täter:innen im Rahmen des Strafverfahrens.
Personen kommen für die antragsbedürftige Gewährung genannter Prozessbegleitungen dann in Betracht, wenn sie Opfer von einzelnen bestimmten Straftaten sind, u.a. von oben genannter Verhetzung, oder sie Opfer von Gewaltdelikten oder Sexualstrafdelikten sind. Opfer u.a. derartiger Straftaten zu sein, ist Voraussetzung. Die Tatsache spezifisch wegen persönlicher Zugehörigkeit zum Kreis von LGBTIQ*-Personen betroffen zu sein, ist (abseits des Tatbestands der Verhetzung) nicht Voraussetzung. Wohl sind LGBTIQ*-Personen von derartigen Delikten aber immer wieder betroffen.
Anders als der Gewährung von sogenannter „Verfahrenshilfe“ (eine andere Form spezifisch juristischer Unterstützung von Prozessparteien) hängt die tatsächliche Gewährung psychosozialer und juristischer Prozessbegleitung nicht von den Vermögens- und Einkommensverhältnissen des Opfers ab. Eine Voraussetzung des Anspruchs auf Prozessbegleitung ist, dass die Gewährung erforderlich sein muss, damit das Opfer seine prozessualen Rechte unter größtmöglichster Bedachtnahme auf seine persönliche Betroffenheit wahren kann. Mit dieser sperrigen Formulierung soll zum Ausdruck gebracht werden, dass leider nicht jedes Opfer – je nach Grad der Betroffenheit – in psychosozialer und juristischer Hinsicht Unterstützung dem Gesetzgeber zu Folge benötigt. Es kommt zu Einzelfallentscheidungen. Es kann auch sein, dass psychosoziale Prozessbegleitung gewährt wird, aber juristische nicht bzw. umgekehrt, dies je nach Lage des Falls.
Grundsätzlich bietet § 66b StPO wirksame Mittel zur Unterstützung von Opfern bestimmter homo- und transfeindlicher Gewalterfahrungen, wenngleich ein weiterer Ausbau dieses Rechtsinstituts wünschenswert wäre. Die praktische Umsetzung der Prozessbegleitung hängt entscheidend auch von der polizeilichen Sensibilität mit LGBTIQ*-Personen als vulnerable Opfergruppe, dem Zugang zu Informationen und dem Willen zur Anwendung ab. Und bessere gesetzgeberische Klarheit zu schaffen, wann tatsächlich mit einer sicheren Gewährung zu rechnen ist, wäre zielführend. Im Übrigen erfolgt die Zuerkennung manchmal zu spät – etwa erst in der Hauptverhandlung, obwohl belastende Situationen häufig schon im Ermittlungsverfahren auftreten – was ebenso ein Kritikpunkt ist.