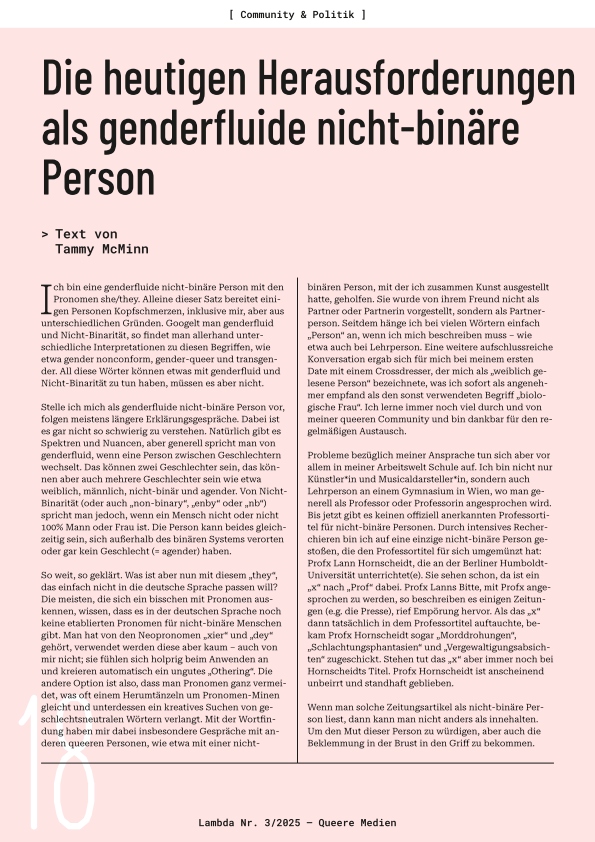Ich bin eine genderfluide nicht-binäre Person mit den Pronomen she/they. Alleine dieser Satz bereitet einigen Personen Kopfschmerzen, inklusive mir, aber aus unterschiedlichen Gründen. Googelt man genderfluid und Nicht-Binarität, so findet man allerhand unterschiedliche Interpretationen zu diesen Begriffen, wie etwa gender nonconform, gender-queer und transgender. All diese Wörter können etwas mit genderfluid und Nicht-Binarität zu tun haben, müssen es aber nicht.
Stelle ich mich als genderfluide nicht-binäre Person vor, folgen meistens längere Erklärungsgespräche. Dabei ist es gar nicht so schwierig zu verstehen. Natürlich gibt es Spektren und Nuancen, aber generell spricht man von genderfluid, wenn eine Person zwischen Geschlechtern wechselt. Das können zwei Geschlechter sein, das können aber auch mehrere Geschlechter sein wie etwa weiblich, männlich, nicht-binär und agender. Von Nicht-Binarität (oder auch „non-binary“, „enby“ oder „nb“) spricht man jedoch, wenn ein Mensch nicht oder nicht 100% Mann oder Frau ist. Die Person kann beides gleichzeitig sein, sich außerhalb des binären Systems verorten oder gar kein Geschlecht (= agender) haben.
So weit, so geklärt. Was ist aber nun mit diesem „they“, das einfach nicht in die deutsche Sprache passen will? Die meisten, die sich ein bisschen mit Pronomen auskennen, wissen, dass es in der deutschen Sprache noch keine etablierten Pronomen für nicht-binäre Menschen gibt. Man hat von den Neopronomen „xier“ und „dey“ gehört, verwendet werden diese aber kaum – auch von mir nicht; sie fühlen sich holprig beim Anwenden an und kreieren automatisch ein ungutes „Othering“. Die andere Option ist also, dass man Pronomen ganz vermeidet, was oft einem Herumtänzeln um Pronomen-Minen gleicht und unterdessen ein kreatives Suchen von geschlechtsneutralen Wörtern verlangt. Mit der Wortfindung haben mir dabei insbesondere Gespräche mit anderen queeren Personen, wie etwa mit einer nicht-binären Person, mit der ich zusammen Kunst ausgestellt hatte, geholfen. Sie wurde von ihrem Freund nicht als Partner oder Partnerin vorgestellt, sondern als Partnerperson. Seitdem hänge ich bei vielen Wörtern einfach „Person“ an, wenn ich mich beschreiben muss – wie etwa auch bei Lehrperson. Eine weitere aufschlussreiche Konversation ergab sich für mich bei meinem ersten Date mit einem Crossdresser, der mich als „weiblich gelesene Person“ bezeichnete, was ich sofort als angenehmer empfand als den sonst verwendeten Begriff „biologische Frau“. Ich lerne immer noch viel durch und von meiner queeren Community und bin dankbar für den regelmäßigen Austausch.
Probleme bezüglich meiner Ansprache tun sich aber vor allem in meiner Arbeitswelt Schule auf. Ich bin nicht nur Künstler*in und Musicaldarsteller*in, sondern auch Lehrperson an einem Gymnasium in Wien, wo man generell als Professor oder Professorin angesprochen wird. Bis jetzt gibt es keinen offiziell anerkannten Professortitel für nicht-binäre Personen. Durch intensives Recherchieren bin ich auf eine einzige nicht-binäre Person gestoßen, die den Professortitel für sich umgemünzt hat: Profx Lann Hornscheidt, die an der Berliner Humboldt-Universität unterrichtet(e). Sie sehen schon, da ist ein „x“ nach „Prof“ dabei. Profx Lanns Bitte, mit Profx angesprochen zu werden, so beschreiben es einigen Zeitungen (e.g. die Presse), rief Empörung hervor. Als das „x“ dann tatsächlich in dem Professortitel auftauchte, bekam Profx Hornscheidt sogar „Morddrohungen“, „Schlachtungsphantasien“ und „Vergewaltigungsabsichten“ zugeschickt. Stehen tut das „x“ aber immer noch bei Hornscheidts Titel. Profx Hornscheidt ist anscheinend unbeirrt und standhaft geblieben.
Wenn man solche Zeitungsartikel als nicht-binäre Person liest, dann kann man nicht anders als innehalten. Um den Mut dieser Person zu würdigen, aber auch die Beklemmung in der Brust in den Griff zu bekommen. Darf ich mir auch ein „x“ nach „Prof“ hinzufügen? Kann ich das einfach übernehmen und für mich offiziell beanspruchen? Darf ich Sprache so eigentlich selbständig verändern und (mit)bestimmen? Will ich mich überhaupt so einem möglichen Wirbelwind an Hass an meinem (Nicht-)Geschlecht und meiner Person aussetzen? Das waren alles meine Gedanken und Ängste, die auf mich einprasselten. Stehen tut das „x“ aber nun dennoch bei meinem Titel als Lehrperson: Profx Tamara McMinn (she/they).
Nicht nur im Schulalltag und in heteronormativen Kreisen, sondern auch im Theater und in der queeren Community kommt das Thema genderfluid und Nicht-Binarität mit all den Missverständnissen auf. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Streitgespräch mit einer Schauspielerin vor ein paar Jahren, als sie mich überzeugen wollte, dass ich sicherlich lesbisch sein müsse. Diese falsche Überzeugung entstand anscheinend dadurch, dass ich gerne Rollen wie etwa Annie (aus „Annie Get Your Gun“) und Robin Hood spielte. (Jedoch spielte ich genauso gerne Rollen wie Elle Woods aus „Legally Blonde!“). Die Sichtbarkeit nicht-binärer Menschen ist nicht zwingend gegeben – unter „queer“ wird oft immer noch in erster Linie Homosexualität verstanden. Nicht-Binärität ist immer noch nicht greifbar für viele. So auch in einigen queeren Buchläden. Sucht man spezifisch nach nicht-binärer oder genderfluiden Literatur, werden mir (nach Aloks Werken) immer noch zuerst Bücher zu den Themen Transgender, Travestie und Drag in die Hände gedrückt. Wieder sind Erklärungsgespräche nötig – auch in einem queeren Space. Der Markt an nicht-binärer genderfluiden Literatur ist noch sehr ausbaufähig; wir sind noch nicht ganz sichtbar.
Diese Unsichtbarkeit von uns ist für mich etwas unverständlich, da wir schon immer existiert haben. Durch die Abwesenheit von nicht-binären und genderfluiden Personen im Alltag fiel es mir als Kind und Teenager schwer mich zu orientieren. Nicht-Binarität, diese und ähnliche Wörter, existierten in den 90ern in meinem kleinen Kärntner-Heimatort nicht. Auch wenn ich noch keine Begriffe für meine Identität hatte, gab es doch diese vielen Momente, in denen ich Erleichterung und innerliche Entspannung spürte, wenn ich mit einer nicht-binären und/oder genderfluiden Person zu tun hatte – sei es im Fernsehen, in Büchern oder im echten Leben. Diese Begegnungen waren wie ein kleines, aber starkes Flüstern: „Die sind wie du und du bist wie die“. Ich weiß also seit 35 Jahren, mit oder ohne damals vorhandene Begriffe, dass genderfluide nicht-binäre Personen existieren. Die Welt fängt jedoch gerade erst an, uns zu entdecken und zu enthüllen. Der langsam geöffnete Raum für uns muss erst noch wirklich gefüllt werden, dabei dürfen wir ruhig aktiv mitwirken.
Zum Glück passiert das aber schon auf einigen Ebenen: z.B. durch dieses Magazin, das Sie gerade in den Händen halten. Und es passieren noch viele andere positive Dinge für uns: Wir sind mehr und mehr in Medien sichtbar (e.g. Jonathan Van Ness, Alok Vaid-Menon, Miley Cyrus, Janelle Monáe, Drag Queen Courtney Act). Weiters bieten Universitäten Gender Studies an und im schulischen Lehrplan ist nun verankert, dass die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Identitäten in den Unterricht aufgenommen werden muss. Auch in meinem persönlichen Leben gibt es zuversichtliche Momente, wie etwa mit dem Elternverein meiner Schule, der sich von Anfang an zur Aufgabe gemacht hat mich immer mit Profx anzusprechen oder auch mit einer Kollegin, die mir die rücksichtsvolle Frage gestellt hat: „Wenn du genderfluid bist, woher weiß ich, wann ich dich mit welchem Pronomen ansprechen soll?“. Oder auch das Gespräch mit einem lieben Freund, dem ich mein Leid klagte, dass ich in queeren Buchläden kaum passende Literatur zu meiner Identität fand und er dann daraufhin selbst hingegangen und mit demselben Frust zurückgekommen war. Diese Momente zählen. So entsteht Sichtbarkeit. Es braucht einerseits unseren Mut, sichtbar zu sein. Aber noch mehr braucht es eine Gesellschaft, die diesen Mut sieht, anerkennt und unterstützt.
Tammy McMinn
Lehrperson an einem Gymnasium, Künstler*in (Insta: mctammy_artist) und Musicaldarstellerin