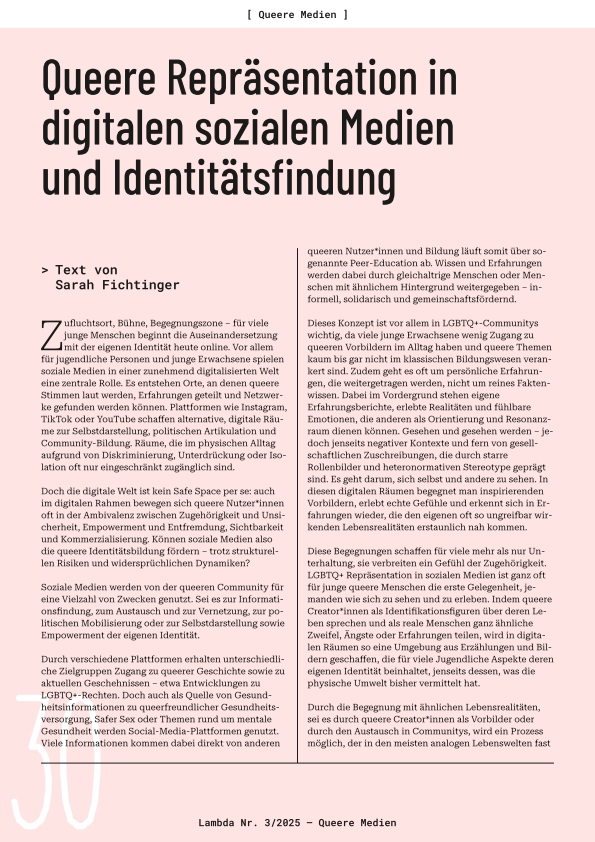Zufluchtsort, Bühne, Begegnungszone – für viele junge Menschen beginnt die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität heute online. Vor allem für jugendliche Personen und junge Erwachsene spielen soziale Medien in einer zunehmend digitalisierten Welt eine zentrale Rolle. Es entstehen Orte, an denen queere Stimmen laut werden, Erfahrungen geteilt und Netzwerke gefunden werden können. Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube schaffen alternative, digitale Räume zur Selbstdarstellung, politischen Artikulation und Community-Bildung. Räume, die im physischen Alltag aufgrund von Diskriminierung, Unterdrückung oder Isolation oft nur eingeschränkt zugänglich sind.
Doch die digitale Welt ist kein Safe Space per se: auch im digitalen Rahmen bewegen sich queere Nutzer*innen oft in der Ambivalenz zwischen Zugehörigkeit und Unsicherheit, Empowerment und Entfremdung, Sichtbarkeit und Kommerzialisierung. Können soziale Medien also die queere Identitätsbildung fördern – trotz strukturellen Risiken und widersprüchlichen Dynamiken?
Soziale Medien werden von der queeren Community für eine Vielzahl von Zwecken genutzt. Sei es zur Informationsfindung, zum Austausch und zur Vernetzung, zur politischen Mobilisierung oder zur Selbstdarstellung sowie Empowerment der eigenen Identität.
Durch verschiedene Plattformen erhalten unterschiedliche Zielgruppen Zugang zu queerer Geschichte sowie zu aktuellen Geschehnissen – etwa Entwicklungen zu LGBTQ+-Rechten. Doch auch als Quelle von Gesundheitsinformationen zu queerfreundlicher Gesundheitsversorgung, Safer Sex oder Themen rund um mentale Gesundheit werden Social-Media-Plattformen genutzt. Viele Informationen kommen dabei direkt von anderen queeren Nutzer*innen und Bildung läuft somit über sogenannte Peer-Education ab. Wissen und Erfahrungen werden dabei durch gleichaltrige Menschen oder Menschen mit ähnlichem Hintergrund weitergegeben – informell, solidarisch und gemeinschaftsfördernd.
Dieses Konzept ist vor allem in LGBTQ+-Communitys wichtig, da viele junge Erwachsene wenig Zugang zu queeren Vorbildern im Alltag haben und queere Themen kaum bis gar nicht im klassischen Bildungswesen verankert sind. Zudem geht es oft um persönliche Erfahrungen, die weitergetragen werden, nicht um reines Faktenwissen. Dabei im Vordergrund stehen eigene Erfahrungsberichte, erlebte Realitäten und fühlbare Emotionen, die anderen als Orientierung und Resonanzraum dienen können. Gesehen und gesehen werden – jedoch jenseits negativer Kontexte und fern von gesellschaftlichen Zuschreibungen, die durch starre Rollenbilder und heteronormativen Stereotype geprägt sind. Es geht darum, sich selbst und andere zu sehen. In diesen digitalen Räumen begegnet man inspirierenden Vorbildern, erlebt echte Gefühle und erkennt sich in Erfahrungen wieder, die den eigenen oft so ungreifbar wirkenden Lebensrealitäten erstaunlich nah kommen.
Diese Begegnungen schaffen für viele mehr als nur Unterhaltung, sie verbreiten ein Gefühl der Zugehörigkeit. LGBTQ+ Repräsentation in sozialen Medien ist ganz oft für junge queere Menschen die erste Gelegenheit, jemanden wie sich zu sehen und zu erleben. Indem queere Creator*innen als Identifikationsfiguren über deren Leben sprechen und als reale Menschen ganz ähnliche Zweifel, Ängste oder Erfahrungen teilen, wird in digitalen Räumen so eine Umgebung aus Erzählungen und Bildern geschaffen, die für viele Jugendliche Aspekte deren eigenen Identität beinhaltet, jenseits dessen, was die physische Umwelt bisher vermittelt hat.
Durch die Begegnung mit ähnlichen Lebensrealitäten, sei es durch queere Creator*innen als Vorbilder oder durch den Austausch in Communitys, wird ein Prozess möglich, der in den meisten analogen Lebenswelten fast nicht stattfinden kann: ein bewusstes, reflektiertes Auseinandersetzen mit der eigenen Identität. Und manchmal genügt ein Swipe zum nächsten Beitrag, um zu erkennen: Ich bin nicht allein.
Entdeckte Ähnlichkeiten zwischen medienpräsenten Personen und queeren Jugendlichen können eine entscheidende Rolle im eigenen Identifikationsprozess spielen. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensrealitäten, Weltanschauungen, Ideen und Werte, die durch Social-Media-Creator*innen oder Menschen aus verschiedenen Communitys aufgezeigt werden, bieten wichtige Impulse, um die eigene Identität zu entwickeln oder zu festigen. Die Identifikation mit der gezeigten Realität von anderen Menschen kann dabei ein Gefühl von Ich-gehöre-dazu auslösen.
Queere Repräsentationen im Netz kann nicht nur durch inspirierende Identifikationsfiguren empowernd wirken, sondern vor allem durch den Austausch und die Vernetzung innerhalb der Community. Durch die Interaktion mit anderen und das aktive Teilen von Inhalten erhalten Jugendliche die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen, Erfahrungen zu teilen oder gemeinsam weiterzuentwickeln. In einer Gesellschaft, in der Heteronormativität oft die Norm vorgibt, wird digitale Sichtbarkeit zu einem kraftvollen Instrument der Selbstermächtigung, indem ein breites Spektrum an Alternativen aufgezeigt wird. Gerade dann, wenn das unmittelbare Umfeld keine queeren Vorbilder bereithält, werden verbündete Menschen und Bezugspersonen im digitalen Raum umso wichtiger. Die Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten durch Social Media eröffnet besonders jenen neue Perspektiven, deren queere Identität im realen Leben kaum sichtbar oder anerkannt ist.
Digitale Räume werden so zu wichtigen Orten des Entdeckens, wo etwa auch Begriffe gefunden werden können, die die eigene Gefühlswelt in Worte fassen. Durch mediale Repräsentationen erhalten viele Menschen Zugang zu Begrifflichkeiten, die ihnen helfen, ihre innere Gefühlswelt besser zu verstehen und einzuordnen. Gleichzeitig bergen festgelegte Begriffe aber auch das Risiko, die individuelle Vielfalt einzuschränken. Wo Kategorien entstehen, können auch Erwartungen wachsen, etwa wie sich jemand mit einem bestimmten Label zu verhalten oder zu fühlen hat. Labels können hilfreich sein, die eigenen Gefühle zu verorten – sofern man das will – und als Orientierungshilfe fungieren, aber sollten nicht zur Schablone werden.
Die Social-Media-Welt ist nicht nur eine Bühne für Empowerment, sondern kann auch schnell ein Ort des Vergleichs werden, der zu vielen Unsicherheiten führt. Perfekt inszenierte Reels, queer codierte Outfits und virale Coming-out-Geschichten können den Eindruck vermitteln, bestimmten Erwartungen entsprechen zu müssen, um als „zugehörig“ wahrgenommen zu werden. Denn wo Repräsentation stattfindet, findet oft auch Ausgrenzung statt. Das Netz ist kein diskriminierungsfreier Raum. Auch innerhalb queerer Bubbles treffen unterschiedliche Meinungen, Normen und Rollenbilder aufeinander. Hate Speech, Gatekeeping oder sozialer Performancedruck können dabei besonders verletzend sein, wenn sie aus einer Community kommen, wo man eigentlich Rückhalt finden will. Gleichzeitig nicht zu vergessen: Strukturelle Faktoren wie etwa das Algorithmus-Verhalten oder Shadowbanning schränken die Sichtbarkeit marginalisierter Zielgruppen zusätzlich ein. Diese Verzerrung der Reichweite bestimmter Inhalte passiert im Stillen und ohne das Wissen der Betroffenen.
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität ist ein vielschichtiger Prozess, egal ob in der analogen oder digitalen Welt. Soziale Medien können dabei unterstützend wirken, doch bergen sie auch Herausforderungen, die nicht unterschätzt werden dürfen. Ob sie letztlich zur Ressource oder Belastung werden, hängt nicht nur von der individuellen Nutzung ab, sondern auch von notwendigen strukturellen Veränderungen in digitalen Räumen. Eine aktive und kritische Auseinandersetzung mit den konsumierten Medieninhalten kann zumindest in Teilen dazu beitragen, soziale Medien als Werkzeug der Selbstermächtigung einzusetzen. In digitalen Räumen geht es nicht nur darum, Queerness sichtbar zu machen, sondern auch darum, sie neu zu denken und in ihrer Vielfalt erfahrbar zu machen.
Text von Sarah Fichtinger,
tätig im Marketing- und Medienbereich