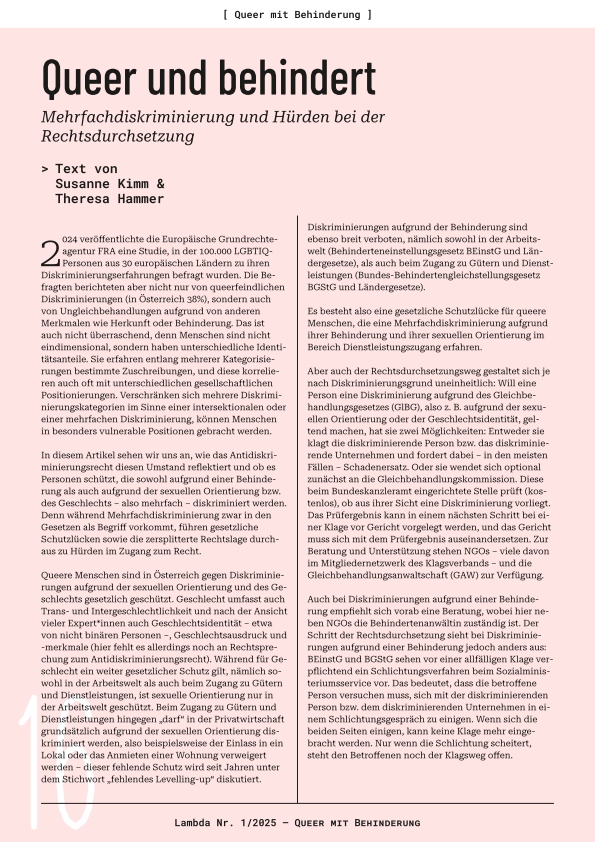Mehrfachdiskriminierung und Hürden bei der Rechtsdurchsetzung
2024 veröffentlichte die Europäische Grundrechteagentur FRA eine Studie, in der 100.000 LGBTIQ-Personen aus 30 europäischen Ländern zu ihren Diskriminierungserfahrungen befragt wurden. Die Befragten berichteten aber nicht nur von queerfeindlichen Diskriminierungen (in Österreich 38%), sondern auch von Ungleichbehandlungen aufgrund von anderen Merkmalen wie Herkunft oder Behinderung. Das ist auch nicht überraschend, denn Menschen sind nicht eindimensional, sondern haben unterschiedliche Identitätsanteile. Sie erfahren entlang mehrerer Kategorisierungen bestimmte Zuschreibungen, und diese korrelieren auch oft mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionierungen. Verschränken sich mehrere Diskriminierungskategorien im Sinne einer intersektionalen oder einer mehrfachen Diskriminierung, können Menschen in besonders vulnerable Positionen gebracht werden.
In diesem Artikel sehen wir uns an, wie das Antidiskriminierungsrecht diesen Umstand reflektiert und ob es Personen schützt, die sowohl aufgrund einer Behinderung als auch aufgrund der sexuellen Orientierung bzw. des Geschlechts – also mehrfach – diskriminiert werden. Denn während Mehrfachdiskriminierung zwar in den Gesetzen als Begriff vorkommt, führen gesetzliche Schutzlücken sowie die zersplitterte Rechtslage durchaus zu Hürden im Zugang zum Recht.
Queere Menschen sind in Österreich gegen Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung und des Geschlechts gesetzlich geschützt. Geschlecht umfasst auch Trans- und Intergeschlechtlichkeit und nach der Ansicht vieler Expert*innen auch Geschlechtsidentität – etwa von nicht binären Personen –, Geschlechtsausdruck und -merkmale (hier fehlt es allerdings noch an Rechtsprechung zum Antidiskriminierungsrecht). Während für Geschlecht ein weiter gesetzlicher Schutz gilt, nämlich sowohl in der Arbeitswelt als auch beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, ist sexuelle Orientierung nur in der Arbeitswelt geschützt. Beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen hingegen „darf“ in der Privatwirtschaft grundsätzlich aufgrund der sexuellen Orientierung diskriminiert werden, also beispielsweise der Einlass in ein Lokal oder das Anmieten einer Wohnung verweigert werden – dieser fehlende Schutz wird seit Jahren unter dem Stichwort „fehlendes Levelling-up“ diskutiert.
Diskriminierungen aufgrund der Behinderung sind ebenso breit verboten, nämlich sowohl in der Arbeitswelt (Behinderteneinstellungsgesetz BEinstG und Ländergesetze), als auch beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz BGStG und Ländergesetze).
Es besteht also eine gesetzliche Schutzlücke für queere Menschen, die eine Mehrfachdiskriminierung aufgrund ihrer Behinderung und ihrer sexuellen Orientierung im Bereich Dienstleistungszugang erfahren.
Aber auch der Rechtsdurchsetzungsweg gestaltet sich je nach Diskriminierungsgrund uneinheitlich: Will eine Person eine Diskriminierung aufgrund des Gleichbehandlungsgesetzes (GlBG), also z. B. aufgrund der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität, geltend machen, hat sie zwei Möglichkeiten: Entweder sie klagt die diskriminierende Person bzw. das diskriminierende Unternehmen und fordert dabei – in den meisten Fällen – Schadenersatz. Oder sie wendet sich optional zunächst an die Gleichbehandlungskommission. Diese beim Bundeskanzleramt eingerichtete Stelle prüft (kostenlos), ob aus ihrer Sicht eine Diskriminierung vorliegt. Das Prüfergebnis kann in einem nächsten Schritt bei einer Klage vor Gericht vorgelegt werden, und das Gericht muss sich mit dem Prüfergebnis auseinandersetzen. Zur Beratung und Unterstützung stehen NGOs – viele davon im Mitgliedernetzwerk des Klagsverbands – und die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW) zur Verfügung.
Auch bei Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung empfiehlt sich vorab eine Beratung, wobei hier neben NGOs die Behindertenanwältin zuständig ist. Der Schritt der Rechtsdurchsetzung sieht bei Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung jedoch anders aus: BEinstG und BGStG sehen vor einer allfälligen Klage verpflichtend ein Schlichtungsverfahren beim Sozialministeriumsservice vor. Das bedeutet, dass die betroffene Person versuchen muss, sich mit der diskriminierenden Person bzw. dem diskriminierenden Unternehmen in einem Schlichtungsgespräch zu einigen. Wenn sich die beiden Seiten einigen, kann keine Klage mehr eingebracht werden. Nur wenn die Schlichtung scheitert, steht den Betroffenen noch der Klagsweg offen.
Was passiert aber, wenn eine Person eine Diskriminierung aufgrund mehrerer Gründe geltend machen will, also Behinderung UND Geschlecht oder Behinderung UND sexuelle Orientierung? Beispielsweise hat die Person eine diskriminierende Beschimpfung oder Mobbingsituation erlebt. Das kann eine rechtlich relevante Belästigung darstellen. Antidiskriminierungsrechtlich fallen darunter alle Verhaltensweisen, die die Würde der betroffenen Person verletzen (können), für die Person unerwünscht sind und ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes Umfeld schaffen. Je nach betroffenem Merkmal sind diese Belästigungsverbote aber in verschiedenen Gesetzen geregelt. Es kann sich daher im Fall einer solchen Mehrfachdiskriminierung bereits im Beratungsprozess die Notwendigkeit ergeben, sich an verschiedene Einrichtungen (zum Beispiel Behindertenanwältin und GAW) zu wenden. Eine gute Kooperation – wie sie auch der Klagsverband mit seinem Netzwerk zu unterstützen versucht – ist dabei unerlässlich. Ist Behinderung einer der mitbetroffenen Diskriminierungsgründe, muss vor einem Gerichtsverfahren verpflichtend ein Schlichtungsversuch unternommen werden. Das kann gerade bei Belästigungssituationen in Mehrfachdiskriminierungskonstellationen besonders belastend für die Betroffenen sein, da ja bei der Schlichtung grundsätzlich eine Einigung erzielt werden soll. Zudem sind Schlichtungsreferent*innen hauptsächlich auf den Diskriminierungsgrund Behinderung geschult und haben womöglich wenig Wissen und Sensibilität bezüglich anderer Diskriminierungsmerkmale.
Gerichtlich kann eine diskriminierungsbetroffene Person in den meisten Fällen nicht die tatsächliche Gleichbehandlung oder die Beseitigung der Diskriminierung einklagen, sondern in erster Linie einen sogenannten immateriellen Schadenersatz für die „erlittene persönliche Beeinträchtigung“. Wenn sich eine Klage auf mehrere Diskriminierungsgründe stützt, also Schadenersatz wegen Mehrfachdiskriminierung eingeklagt wird, muss das Gericht nach den Antidiskriminierungsgesetzen die Mehrfachdiskriminierung bei der Bemessung der Schadenshöhe berücksichtigen. Das bedeutet, dass in diesen Fällen ein höherer Schadenersatz zugesprochen werden kann als bei „einfacher“ Diskriminierung. Eine Anerkennung der Mehrfachdiskriminierung durch das Gesetz auf dieser Ebene ist wichtig. Aus Erfahrung des Klagsverbands entsprechen die zugesprochenen Schadenersatzbeträge für erlebte Diskriminierungen aber leider ganz generell nur partiell den gesetzlichen Vorgaben, tatsächlich wirksam, verhältnismäßig und abschreckend zu sein.
Um dem Zusammenwirken von Diskriminierungsgründen gerecht zu werden, braucht es für die Betroffenen Gesetze, die diese Realitäten abbilden. Neben effektiveren Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten könnte auch eine gesetzliche Definition von intersektionaler bzw. Mehrfachdiskriminierung zur Sichtbarkeit und Rechtssicherheit beitragen – für Diskriminierungsbetroffene und für Rechtsanwender*innen wie z.B. Richter*innen. Zudem braucht es gute Beratung, die Betroffene in ihren multidimensionalen Diskriminierungserfahrungen ernst nimmt und mit ihnen gemeinsam Handlungsmöglichkeiten entwickelt. Ein guter Austausch zwischen verschiedenen Beratungsstellen ist dafür eine wichtige Basis. Der Klagsverband arbeitet daher kontinuierlich daran, seine Mitgliedsorganisationen zu vernetzen, um voneinander zu lernen und das Verständnis von unterschiedlichen Diskriminierungsdimensionen und ihrem Zusammenwirken zu erweitern und zu vertiefen.
Susanne Kimm
Juristische Mitarbeiterin für Rechtsberatung und Rechtsdurchsetzung
Theresa Hammer
Geschäftsführerin und Leiterin der Rechtsberatung und Rechtsdurchsetzung
Klagsverband
www.klagsverband.at