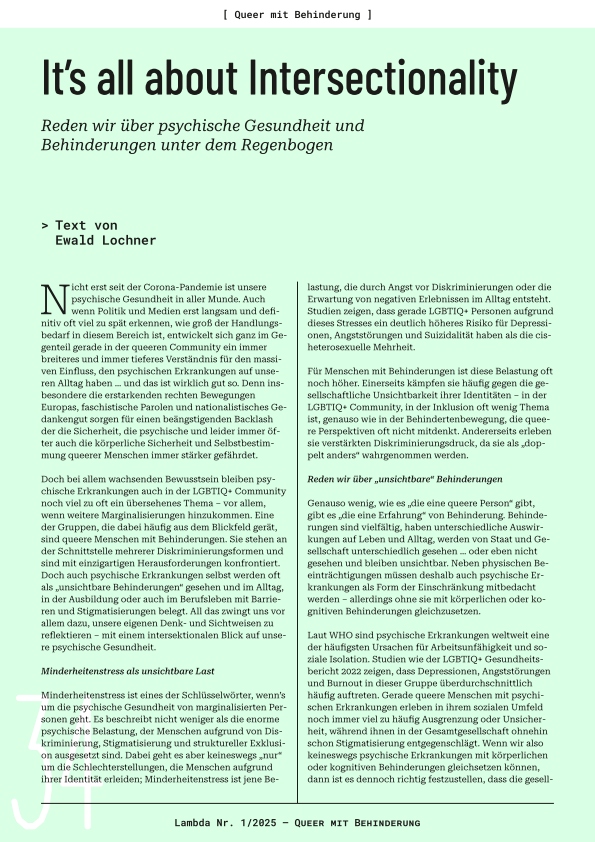Reden wir über psychische Gesundheit und Behinderungen unter dem Regenbogen
Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist unsere psychische Gesundheit in aller Munde. Auch wenn Politik und Medien erst langsam und definitiv oft viel zu spät erkennen, wie groß der Handlungsbedarf in diesem Bereich ist, entwickelt sich ganz im Gegenteil gerade in der queeren Community ein immer breiteres und immer tieferes Verständnis für den massiven Einfluss, den psychischen Erkrankungen auf unseren Alltag haben … und das ist wirklich gut so. Denn insbesondere die erstarkenden rechten Bewegungen Europas, faschistische Parolen und nationalistisches Gedankengut sorgen für einen beängstigenden Backlash der die Sicherheit, die psychische und leider immer öfter auch die körperliche Sicherheit und Selbstbestimmung queerer Menschen immer stärker gefährdet.
Doch bei allem wachsenden Bewusstsein bleiben psychische Erkrankungen auch in der LGBTIQ+ Community noch viel zu oft ein übersehenes Thema – vor allem, wenn weitere Marginalisierungen hinzukommen. Eine der Gruppen, die dabei häufig aus dem Blickfeld gerät, sind queere Menschen mit Behinderungen. Sie stehen an der Schnittstelle mehrerer Diskriminierungsformen und sind mit einzigartigen Herausforderungen konfrontiert. Doch auch psychische Erkrankungen selbst werden oft als „unsichtbare Behinderungen“ gesehen und im Alltag, in der Ausbildung oder auch im Berufsleben mit Barrieren und Stigmatisierungen belegt. All das zwingt uns vor allem dazu, unsere eigenen Denk- und Sichtweisen zu reflektieren – mit einem intersektionalen Blick auf unsere psychische Gesundheit.
Minderheitenstress als unsichtbare Last
Minderheitenstress ist eines der Schlüsselwörter, wenn’s um die psychische Gesundheit von marginalisierten Personen geht. Es beschreibt nicht weniger als die enorme psychische Belastung, der Menschen aufgrund von Diskriminierung, Stigmatisierung und struktureller Exklusion ausgesetzt sind. Dabei geht es aber keineswegs „nur“ um die Schlechterstellungen, die Menschen aufgrund ihrer Identität erleiden; Minderheitenstress ist jene Belastung, die durch Angst vor Diskriminierungen oder die Erwartung von negativen Erlebnissen im Alltag entsteht. Studien zeigen, dass gerade LGBTIQ+ Personen aufgrund dieses Stresses ein deutlich höheres Risiko für Depressionen, Angststörungen und Suizidalität haben als die cis-heterosexuelle Mehrheit.
Für Menschen mit Behinderungen ist diese Belastung oft noch höher. Einerseits kämpfen sie häufig gegen die gesellschaftliche Unsichtbarkeit ihrer Identitäten – in der LGBTIQ+ Community, in der Inklusion oft wenig Thema ist, genauso wie in der Behindertenbewegung, die queere Perspektiven oft nicht mitdenkt. Andererseits erleben sie verstärkten Diskriminierungsdruck, da sie als „doppelt anders“ wahrgenommen werden.
Reden wir über „unsichtbare“ Behinderungen
Genauso wenig, wie es „die eine queere Person“ gibt, gibt es „die eine Erfahrung“ von Behinderung. Behinderungen sind vielfältig, haben unterschiedliche Auswirkungen auf Leben und Alltag, werden von Staat und Gesellschaft unterschiedlich gesehen … oder eben nicht gesehen und bleiben unsichtbar. Neben physischen Beeinträchtigungen müssen deshalb auch psychische Erkrankungen als Form der Einschränkung mitbedacht werden – allerdings ohne sie mit körperlichen oder kognitiven Behinderungen gleichzusetzen.
Laut WHO sind psychische Erkrankungen weltweit eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit und soziale Isolation. Studien wie der LGBTIQ+ Gesundheitsbericht 2022 zeigen, dass Depressionen, Angststörungen und Burnout in dieser Gruppe überdurchschnittlich häufig auftreten. Gerade queere Menschen mit psychischen Erkrankungen erleben in ihrem sozialen Umfeld noch immer viel zu häufig Ausgrenzung oder Unsicherheit, während ihnen in der Gesamtgesellschaft ohnehin schon Stigmatisierung entgegenschlägt. Wenn wir also keineswegs psychische Erkrankungen mit körperlichen oder kognitiven Behinderungen gleichsetzen können, dann ist es dennoch richtig festzustellen, dass die gesellschaftlichen Hürden und Diskriminierungsmechanismen, mit denen diese Gruppen konfrontiert sind, sich ähneln.
Fakt ist: Unser Zugang zu Themen wie Queerness, Behinderung und psychische Gesundheit muss so intersektional sein, wie die Hürden, mit denen wir konfrontiert sind. Besonders deutlich wird das im Gesundheitsbereich! Die mangelnde Sensibilisierung vieler Ärzt*innen und Expert*innen für intersektionale Diskriminierungen ist schließlich bis heute ein zentraler Grund für die negativen Erfahrungen, die viele Menschen im Kontakt mit dem Gesundheitswesen erleben müssen. Genauso entscheidend sind das Fehlen bundesweiter Ressourcen, das fehlende Wissen über intersektionale Diskriminierungen bei Ärzt*innen oder die anhaltende Pathologisierung zahlreicher Identitäten. Diese und andere Hindernisse führen dazu, dass viele Betroffene dringend benötigte medizinische, psychiatrische oder therapeutische Unterstützung meiden oder nicht erhalten.
Volle Teilhabe als Ziel
Was muss sich ändern? Wenn volle Teilhabe unser Ziel ist, dann wird es in Zukunft darum gehen müssen, nicht nur Strukturen zu verändern, sondern auch unseren intersektionalen Blick auf Hürden und Herausforderungen im Alltag zu schärfen – ganz besonders auch als queere Community. Damit können wir schon in unseren eigenen Räumen beginnen: Mehr Augenmerk für Barrierefreiheit und Teilhabe können dabei einen wichtigen Beitrag leisten und zwar sowohl was Behinderungen als auch psychische Erkrankungen angeht. Vor allem aber geht es darum, die Stimmen jener Menschen zu stärken, die von intersektionalen Diskriminierungen betroffen sind. Es geht nicht darum, Räume für marginalisierte Gruppen besser zu machen, sondern sie mit ihnen so zu gestalten, dass sie für alle von uns besser funktionieren!
Die vorhin schon angesprochene Wahrnehmung von psychischen Erkrankungen als „unsichtbare“ Einschränkungen sind dafür wohl das beste Beispiel: Viele von uns sind in ihrem Leben zumindest einmal von einer solchen Erkrankung betroffen. Strukturen und Communitys, die sensibel und ohne Stigma mit unserer psychischen Gesundheit umgehen, machen das Leben deshalb nicht nur für jene von uns besser, die gerade an einer depressiven Erkrankung leiden, sondern helfen zum einen oder anderen Zeitpunkt den meisten von uns einmal. Dasselbe trifft für barrierefreie Räume zu, für die Verwendung von leichter Sprache oder für gute Peer-to-Peer-Unterstützungssysteme.
Auch über unsere Community hinaus gibt es viel zu tun. Diese Schritte werden auch von uns erfordern, dass wir als queere Menschen uns lauter und stärker zu gesamtgesellschaftlichen Fragen äußern, dass wir Bündnisse mit anderen Gruppen eingehen und dass wir unseren politischen Horizont und unsere Forderungen erweitern: Wir müssen uns stärker mit der Sensibilisierung des Gesundheitspersonals beschäftigen und dafür von der Politik auch die Ressourcen einfordern. Ärzt*innen, Therapeut*innen oder Pfleger*innen müssen über intersektionale Diskriminierung Bescheid wissen. Genauso braucht es mehr Mittel für barrierefreie psychosoziale Angebote – kommunikative Barrieren müssen in allen Therapie-, Beratungs- und Behandlungssettings abgebaut werden. In Wien leisten genau dafür schon die Psychosozialen Dienste viel Arbeit und setzen wichtige Schwerpunkte. Mit der Sorgenhotline bieten wir zum Beispiel eine niederschwellige Anlaufstelle für psychische Belastungen. Dabei merken wir aber, dass es bundesweite Mittel und Schwerpunkte für eine inklusive Gesundheitsversorgung braucht, eine Stadt allein kann das nicht stemmen.
Vor allem aber wird es um eine Sache gehen: Wir müssen psychische Gesundheit, Behinderungen, intersektionale Diskriminierungen und deren Auswirkungen auch in unserer eigenen Community sichtbarer machen! Und wir müssen darüber reden. Wir müssen sowohl die Stimmen von Betroffenen vielfältiger Diskriminierungen stärken als auch als Allys offen und aktiv den Diskurs darüber stärken – deshalb ist es gerade mir, als schwulem Mann ohne Behinderung, so wichtig, diese Fragen zu thematisieren: Psychische Gesundheit und Behinderung müssen als Teil der queeren Realität anerkannt werden. Nur durch intersektionale Perspektiven können wir echte Gleichstellung und Teilhabe erreichen – im Gesundheitssystem, in der Community und in der gesamten Gesellschaft.
Denn echte Inklusion beginnt dort, wo wir die ganze Vielfalt queerer Menschen sehen und ernst nehmen.
Factbox
Unter dem Motto „Psychische Gesundheit unter dem Regenbogen“ haben die Psychosozialen Dienste in Wien (PSD-Wien) und die HOSI Wien eine eigene Broschüre veröffentlicht. Diese und weitere Informationen findest du unter https://psd-wien.at/projekt/regenbogen
Die Sorgenhotline Wien bietet unter 01/4000-53000 eine erste Anlaufstelle bei psychosozialen Belastungen für alle Menschen in Wien.
In Krisen ist die Sozialpsychiatrische Soforthilfe des PSD-Wien rund um die Uhr erreichbar:
0131330