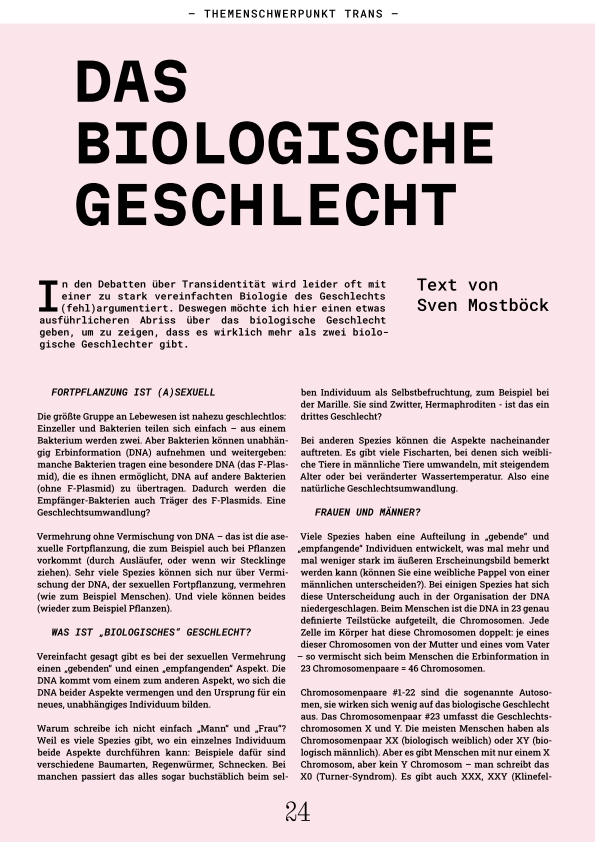In den Debatten über Transidentität wird leider oft mit einer zu stark vereinfachten Biologie des Geschlechts (fehl)argumentiert. Deswegen möchte ich hier einen etwas ausführlicheren Abriss über das biologische Geschlecht geben, um zu zeigen, dass es wirklich mehr als zwei biologische Geschlechter gibt.
Fortpflanzung ist (a)sexuell
Die größte Gruppe an Lebewesen ist nahezu geschlechtlos: Einzeller und Bakterien teilen sich einfach – aus einem Bakterium werden zwei. Aber Bakterien können unabhängig Erbinformation (DNA) aufnehmen und weitergeben: manche Bakterien tragen eine besondere DNA (das F-Plasmid), die es ihnen ermöglicht, DNA auf andere Bakterien (ohne F-Plasmid) zu übertragen. Dadurch werden die Empfänger-Bakterien auch Träger des F-Plasmids. Eine Geschlechtsumwandlung?
Vermehrung ohne Vermischung von DNA – das ist die asexuelle Fortpflanzung, die zum Beispiel auch bei Pflanzen vorkommt (durch Ausläufer, oder wenn wir Stecklinge ziehen). Sehr viele Spezies können sich nur über Vermischung der DNA, der sexuellen Fortpflanzung, vermehren (wie zum Beispiel Menschen). Und viele können beides (wieder zum Beispiel Pflanzen).
Was ist „biologisches“ Geschlecht?
Vereinfacht gesagt gibt es bei der sexuellen Vermehrung einen „gebenden“ und einen „empfangenden“ Aspekt. Die DNA kommt vom einem zum anderen Aspekt, wo sich die DNA beider Aspekte vermengen und den Ursprung für ein neues, unabhängiges Individuum bilden.
Warum schreibe ich nicht einfach „Mann“ und „Frau“? Weil es viele Spezies gibt, wo ein einzelnes Individuum beide Aspekte durchführen kann: Beispiele dafür sind verschiedene Baumarten, Regenwürmer, Schnecken. Bei manchen passiert das alles sogar buchstäblich beim selben Individuum als Selbstbefruchtung, zum Beispiel bei der Marille. Sie sind Zwitter, Hermaphroditen – ist das ein drittes Geschlecht?
Bei anderen Spezies können die Aspekte nacheinander auftreten. Es gibt viele Fischarten, bei denen sich weibliche Tiere in männliche Tiere umwandeln, mit steigendem Alter oder bei veränderter Wassertemperatur. Also eine natürliche Geschlechtsumwandlung.
Frauen und Männer?
Viele Spezies haben eine Aufteilung in „gebende“ und „empfangende“ Individuen entwickelt, was mal mehr und mal weniger stark im äußeren Erscheinungsbild bemerkt werden kann (können Sie eine weibliche Pappel von einer männlichen unterscheiden?). Bei einigen Spezies hat sich diese Unterscheidung auch in der Organisation der DNA niedergeschlagen. Beim Menschen ist die DNA in 23 genau definierte Teilstücke aufgeteilt, die Chromosomen. Jede Zelle im Körper hat diese Chromosomen doppelt: je eines dieser Chromosomen von der Mutter und eines vom Vater – so vermischt sich beim Menschen die Erbinformation in 23 Chromosomenpaare = 46 Chromosomen.
Chromosomenpaare #1-22 sind die sogenannte Autosomen, sie wirken sich wenig auf das biologische Geschlecht aus. Das Chromosomenpaar #23 umfasst die Geschlechtschromosomen X und Y. Die meisten Menschen haben als Chromosomenpaar XX (biologisch weiblich) oder XY (biologisch männlich). Aber es gibt Menschen mit nur einem X Chromosom, aber kein Y Chromosom – man schreibt das X0 (Turner-Syndrom). Es gibt auch XXX, XXY (Klinefelter-Syndrom) oder auch XYY. Sind sie nun „Frauen“ oder „Männer“? Sind sie ein drittes Geschlecht? Oder ein Zwischengeschlecht?
Von den Chromosomen zum Körper
Die DNA ist die Blaupause, das Rezept, nach dem der Körper ausgehend von einer einzelnen befruchteten Eizelle aufgebaut wird. Das ist ein interaktiver Prozess mit starker gegenseitiger Beeinflussung aller Komponenten.
Im Prinzip haben alle Menschen die gleichen Organe mit den gleichen Funktionen – Lunge, Herz, Leber und so weiter. Auch die Geschlechtsorgane haben im Prinzip die gleiche Funktion – Bereitstellen der Keimzellen (Eizelle und Samenzelle) für die Vermischung der DNA bei der Fortpflanzung. Aber beim Menschen hat sich zusätzlich noch eine ausgeprägte Unterstützungsfunktion für die Nachkommen entwickelt – das Austragen und Säugen. Deswegen gibt es unterschiedliche geschlechtsbezogene Organe: Vulva, Ovarien, Vagina, Uterus, milcherzeugendes Brustgewebe, Penis, Hoden, Prostata und viele weitere.
Aber am Anfang, im Embryo, finden sich die gleichen Gewebsansätze. Erst durch die Aktivität der Geschlechtschromosomen und der freigesetzten Geschlechtshormone (Östrogen, Testosteron) entwickeln sich diese gleichen Ansätze in unterschiedliche Richtungen. Dieser komplexe Prozess führt zu den üblichen biologischen Variationen – unterschiedliche Größe und Formen bei den äußeren Geschlechtsorganen sind offen sichtbar. Darüber hinaus gibt es Personen, bei denen sich die Geschlechtsorgane mehr oder weniger stark als Zwischenformen oder Doppelformen entwickeln, was unter dem Begriff „Intergeschlechtlichkeit“ zusammengefasst wird.
Ist nun also Intergeschlechtlichkeit das „dritte biologische Geschlecht“?
Körper und Geist
Es wird viel von den primären und sekundären Geschlechtsorganen gesprochen, wenn es um das biologische Geschlecht geht. Aber ein Organ kommt dazu: das Gehirn.
Das Gehirn ist der biologische Grund für unseren Geist, unser Bewusstsein, unser „Ich“. Bei Geschlecht und Vermehrung muss das Gehirn mehrere Aufgaben übernehmen: unter anderem das Erkennen des eigenen Geschlechts, das Erkennen des Geschlechts anderer Personen, und das Verlangen nach anderen Personen (oft limitiert auf ein bestimmtes Geschlecht). Wie diese Festlegungen passieren, ist noch nicht geklärt. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Erbinformation, Botenstoffen im Körper, Einflüsse aus der Umwelt und der Kultur, und schlichtem Zufall. Dabei findet die Ausformulierung des Verständnisses zum eigenen Geschlecht deutlich vor der Pubertät statt, wohl schon deutlich vor der Ausformulierung der eigenen sexuellen Orientierung.
Und nun die Krux: auch diese biologische Funktion des Gehirns ist variabel und nicht bei allen Menschen gleich. Das führt dazu, dass manche Personen sich als „weiblich“, „männlich“, „beides“, „keines von beidem“ erleben, auch wenn ihre anderen Geschlechtsmerkmale, Chromosomen und/oder die ausgebildeten Geschlechtsorgane, auf ein anderes Geschlecht hinweisen. Das ist die Basis von trans und nicht-binärer Geschlechtsidentität.
Das Gehirn ist Teil des Körpers und Teil der Biologie des Menschen. Damit ist auch das Bewusstsein ein Teil des biologischen Geschlechts. Man kann Gehirn und Bewusstsein nicht willkürlich vom Rest des Körpers abtrennen.
Eine veraltete Argumentation
Man sieht, eine binäre Kategorisierung in „männlich“ und „weiblich“, oder sogar „Mann“ und „Frau“, ist bei all den real existierenden biologischen Variationen nicht möglich.
Intergeschlechtlichkeit wurde lange Zeit von Medizin und Gesellschaft als „inkorrekt“ oder „krank“ behandelt. Vereine wie die „Plattform Intersex Österreich“ und der „Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich (VIMÖ)“ klären seit Jahren unermüdlich dazu auf, dass neben den zwei erlaubten Kategorien „Mann“ und „Frau“ ein weites Spektrum an Geschlechtsmerkmalen ohne Kategorien existiert. Bei trans Personen kommt nun wieder das fehlerhafte Argument von nur zwei möglichen Kategorien: „biologischer Mann erlebt sich als Mann“ und „biologische Frau erlebt sich als Frau“. Erneut zeigt sich, dass biologisch hier gar keine Kategorien möglich sind, sondern ein weites Spektrum an Geschlechtsidentifikation durch das Bewusstsein auftritt.
Bei der sexuellen Orientierung wurde all das bereits durchgekämpft: aus dem Verbrechen wider die Natur wurde die natürliche Variation des menschlichen Verlangens außerhalb jeder Kategorie, die es biologisch immer schon war.
Wahrscheinlich sind die heterosexuellen cis Personen mit „üblichen“ Geschlechtsmerkmalen die größte Personengruppe unter den Menschen. Aber das bedeutet nicht, dass die Existenz anderer Lebensrealitäten verleugnet werden kann. Denn sie beruhen auf objektiven wissenschaftlichen Fakten, Teil der biologischen Wahrheit, dass es mehr gibt als nur zwei biologische Geschlechter.