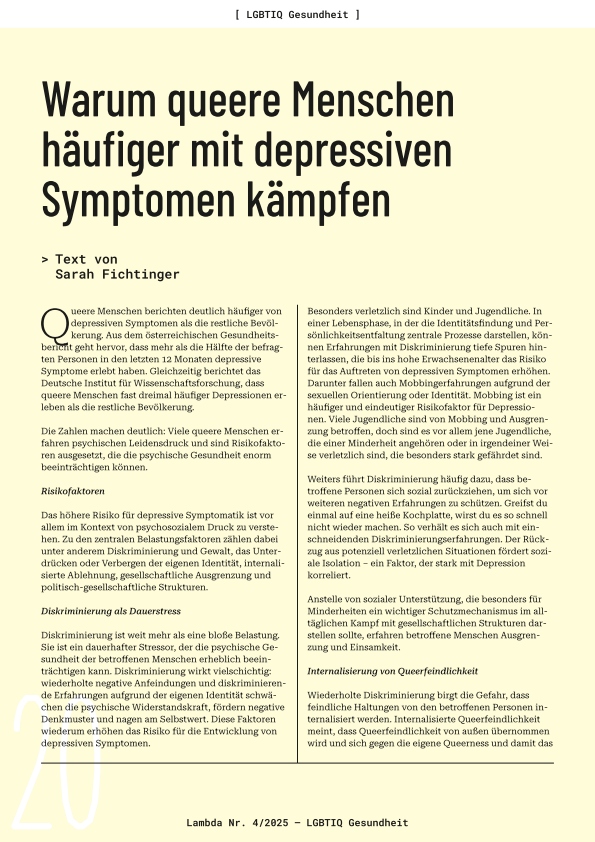Queere Menschen berichten deutlich häufiger von depressiven Symptomen als die restliche Bevölkerung. Aus dem österreichischen Gesundheitsbericht geht hervor, dass mehr als die Hälfte der befragten Personen in den letzten 12 Monaten depressive Symptome erlebt haben. Gleichzeitig berichtet das Deutsche Institut für Wissenschaftsforschung, dass queere Menschen fast dreimal häufiger Depressionen erleben als die restliche Bevölkerung.
Die Zahlen machen deutlich: Viele queere Menschen erfahren psychischen Leidensdruck und sind Risikofaktoren ausgesetzt, die die psychische Gesundheit enorm beeinträchtigen können.
Risikofaktoren
Das höhere Risiko für depressive Symptomatik ist vor allem im Kontext von psychosozialem Druck zu verstehen. Zu den zentralen Belastungsfaktoren zählen dabei unter anderem Diskriminierung und Gewalt, das Unterdrücken oder Verbergen der eigenen Identität, internalisierte Ablehnung, gesellschaftliche Ausgrenzung und politisch-gesellschaftliche Strukturen.
Diskriminierung als Dauerstress
Diskriminierung ist weit mehr als eine bloße Belastung. Sie ist ein dauerhafter Stressor, der die psychische Gesundheit der betroffenen Menschen erheblich beeinträchtigen kann. Diskriminierung wirkt vielschichtig: wiederholte negative Anfeindungen und diskriminierende Erfahrungen aufgrund der eigenen Identität schwächen die psychische Widerstandskraft, fördern negative Denkmuster und nagen am Selbstwert. Diese Faktoren wiederum erhöhen das Risiko für die Entwicklung von depressiven Symptomen.
Besonders verletzlich sind Kinder und Jugendliche. In einer Lebensphase, in der die Identitätsfindung und Persönlichkeitsentfaltung zentrale Prozesse darstellen, können Erfahrungen mit Diskriminierung tiefe Spuren hinterlassen, die bis ins hohe Erwachsenenalter das Risiko für das Auftreten von depressiven Symptomen erhöhen. Darunter fallen auch Mobbingerfahrungen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Identität. Mobbing ist ein häufiger und eindeutiger Risikofaktor für Depressionen. Viele Jugendliche sind von Mobbing und Ausgrenzung betroffen, doch sind es vor allem jene Jugendliche, die einer Minderheit angehören oder in irgendeiner Weise verletzlich sind, die besonders stark gefährdet sind.
Weiters führt Diskriminierung häufig dazu, dass betroffene Personen sich sozial zurückziehen, um sich vor weiteren negativen Erfahrungen zu schützen. Greifst du einmal auf eine heiße Kochplatte, wirst du es so schnell nicht wieder machen. So verhält es sich auch mit einschneidenden Diskriminierungserfahrungen. Der Rückzug aus potenziell verletzlichen Situationen fördert soziale Isolation – ein Faktor, der stark mit Depression korreliert.
Anstelle von sozialer Unterstützung, die besonders für Minderheiten ein wichtiger Schutzmechanismus im alltäglichen Kampf mit gesellschaftlichen Strukturen darstellen sollte, erfahren betroffene Menschen Ausgrenzung und Einsamkeit.
Internalisierung von Queerfeindlichkeit
Wiederholte Diskriminierung birgt die Gefahr, dass feindliche Haltungen von den betroffenen Personen internalisiert werden. Internalisierte Queerfeindlichkeit meint, dass Queerfeindlichkeit von außen übernommen wird und sich gegen die eigene Queerness und damit das eigene Selbst richtet. Das führt zu schweren Identitätskrisen, Selbstvorwürfen bis hin zu Selbsthass und Schuldgefühlen.
Die eigene Identität wird hinterfragt, das Selbstbewusstsein leidet massiv, Schamgefühle und Angst beherrschen die Gefühlswelt und ein innerer Konflikt entsteht, der wie ein ständiger Angriff auf die eigene psychische Gesundheit wirkt. Emotionale Erschöpfung bleibt hier auf Dauer nicht aus. Langfristig führen diese Spannungen zu einem Zustand dauerhafter Selbstabwertung. Die ständige Konfrontation mit Gefühlen, die einem sagen, nicht „richtig“, nicht „genug“ zu sein, schwächt das Vertrauen in sich selbst, kann zu vermehrtem Vermeidungsverhalten und sozialem Rückzug führen. All diese Faktoren wirken zusammen und können einen erhöhten Risikofaktor für depressive Symptome darstellen.
Verborgene Identitäten
Sich selbst zu verstecken, zehrt an den Kräften. Gesellschaftliche Rollenbilder gehen tief. Oft so tief, dass sich viele queere Personen gezwungen fühlen, Rollen anzunehmen, die nicht deren eigenen (queeren) Identität entsprechen. Dabei wird mit allen Mitteln versucht, den gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen. Und das sogar mit gutem Grund, denn die Alternative kann schmerzhaft sein: Diskriminierungserfahrungen, Gewaltdelikte, Ablehnung von der eigenen Familie, strukturelle Ungleichheiten. So sind viele Menschen gezwungen, sich dem heteronormativen Ideal anzupassen und die eigene Identität zu verstecken. Das eigene Leben wird zum Rollenspiel inszeniert. So können schon kleine Alltagssituationen zu enormen Belastungen werden, denn wer ständig alle Alarmglocken aktiviert haben muss, sei es als queeres Paar in der U-Bahn oder bei Wahl der „richtigen“ Toilette, lebt in einem Ausnahmezustand.
Diese Daueranspannung hinterlässt Spuren und erhöht das Risiko für depressive Symptomatik deutlich.
Strukturelle Benachteiligung
Für queere Menschen ist der Weg zu medizinischer Versorgung voller Hürden: Diskriminierung am Arbeits- und Wohnungsmarkt, die zu finanziellen Unsicherheiten führt, Standardformulare, die nur cis-heterosexuelle Normen kennen, langwierige Begutachtungsverfahren, um medizinische Maßnahmen zu bekommen. Diese und noch viele weitere Aspekte stellen strukturelle Benachteiligungen dar, denen queere Menschen tagtäglich ausgesetzt sind.
Diese machen es vielen queeren Menschen unmöglich, eine angemessene Gesundheitsversorgung, Präventionsangebote oder psychologische Hilfe zu erhalten. Sei es aus Angst vor Ablehnung oder Diskriminierung, aus finanziellen Gründen, wegen bürokratischer Belastungen oder schlicht, weil die passenden Angebote gar nicht vorhanden sind. Solche Ungleichheiten sind ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen und verstärken zudem bereits bestehende Belastungen.
Vielfalt bei der Entstehung
Depressive Symptome können viele Gesichter und Ursachen haben. Die genannten Belastungen sind als mögliche Risikofaktoren zu verstehen, die zusammenspielen und zu Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit führen können. Klar ist jedoch: Queere Menschen kämpfen oft nicht nur mit inneren Konflikten, sondern auch mit der Last struktureller Ungleichheiten. Gleichzeitig entsteht aber Resilienz gegenüber diesen Faktoren nicht nur durch individuelle Widerstandskraft, sondern ganz wesentlich durch soziale Unterstützung und politisch-gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Das zu erkennen wird Politik und Gesellschaft nicht über Nacht grundlegend verändern. Wird das Bewusstsein jedoch dafür geschärft, dass queere Menschen in vielen Lebensbereichen weniger Chancen haben und große Bürden tragen, so kann dieses Bewusstsein betroffenen Personen zumindest Verständnis und Solidarität entgegenbringen.