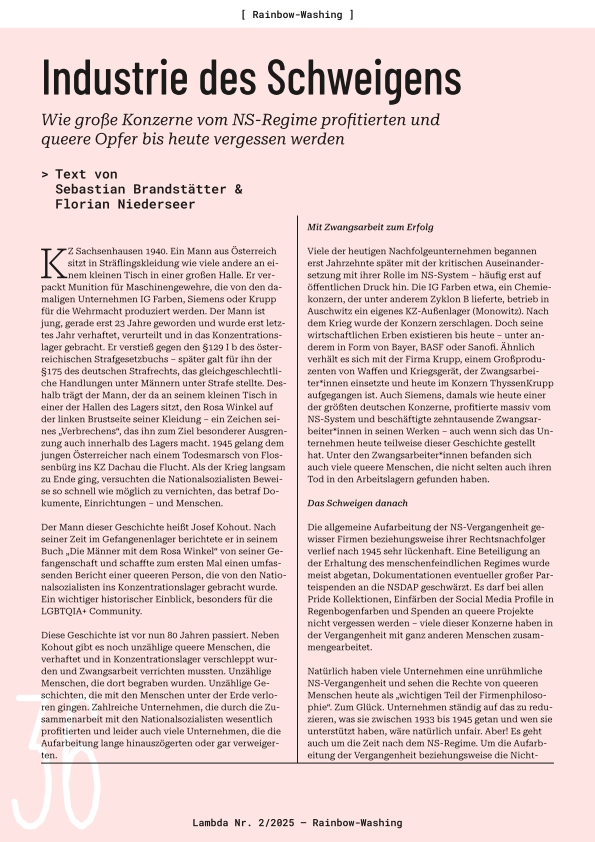Wie große Konzerne vom NS-Regime profitierten und queere Opfer bis heute vergessen werden
KZ Sachsenhausen 1940. Ein Mann aus Österreich sitzt in Sträflingskleidung wie viele andere an einem kleinen Tisch in einer großen Halle. Er verpackt Munition für Maschinengewehre, die von den damaligen Unternehmen IG Farben, Siemens oder Krupp für die Wehrmacht produziert werden. Der Mann ist jung, gerade erst 23 Jahre geworden und wurde erst letztes Jahr verhaftet, verurteilt und in das Konzentrationslager gebracht. Er verstieß gegen den §129 I b des österreichischen Strafgesetzbuchs – später galt für ihn der §175 des deutschen Strafrechts, das gleichgeschlechtliche Handlungen unter Männern unter Strafe stellte. Deshalb trägt der Mann, der da an seinem kleinen Tisch in einer der Hallen des Lagers sitzt, den Rosa Winkel auf der linken Brustseite seiner Kleidung – ein Zeichen seines „Verbrechens“, das ihn zum Ziel besonderer Ausgrenzung auch innerhalb des Lagers macht. 1945 gelang dem jungen Österreicher nach einem Todesmarsch von Flossenbürg ins KZ Dachau die Flucht. Als der Krieg langsam zu Ende ging, versuchten die Nationalsozialisten Beweise so schnell wie möglich zu vernichten, das betraf Dokumente, Einrichtungen – und Menschen.
Der Mann dieser Geschichte heißt Josef Kohout. Nach seiner Zeit im Gefangenenlager berichtete er in seinem Buch „Die Männer mit dem Rosa Winkel“ von seiner Gefangenschaft und schaffte zum ersten Mal einen umfassenden Bericht einer queeren Person, die von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager gebracht wurde. Ein wichtiger historischer Einblick, besonders für die LGBTQIA+ Community.
Diese Geschichte ist vor nun 80 Jahren passiert. Neben Kohout gibt es noch unzählige queere Menschen, die verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt wurden und Zwangsarbeit verrichten mussten. Unzählige Menschen, die dort begraben wurden. Unzählige Geschichten, die mit den Menschen unter der Erde verloren gingen. Zahlreiche Unternehmen, die durch die Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten wesentlich profitierten und leider auch viele Unternehmen, die die Aufarbeitung lange hinauszögerten oder gar verweigerten.
Mit Zwangsarbeit zum Erfolg
Viele der heutigen Nachfolgeunternehmen begannen erst Jahrzehnte später mit der kritischen Auseinandersetzung mit ihrer Rolle im NS-System – häufig erst auf öffentlichen Druck hin. Die IG Farben etwa, ein Chemiekonzern, der unter anderem Zyklon B lieferte, betrieb in Auschwitz ein eigenes KZ-Außenlager (Monowitz). Nach dem Krieg wurde der Konzern zerschlagen. Doch seine wirtschaftlichen Erben existieren bis heute – unter anderem in Form von Bayer, BASF oder Sanofi. Ähnlich verhält es sich mit der Firma Krupp, einem Großproduzenten von Waffen und Kriegsgerät, der Zwangsarbeiter*innen einsetzte und heute im Konzern ThyssenKrupp aufgegangen ist. Auch Siemens, damals wie heute einer der größten deutschen Konzerne, profitierte massiv vom NS-System und beschäftigte zehntausende Zwangsarbeiter*innen in seinen Werken – auch wenn sich das Unternehmen heute teilweise dieser Geschichte gestellt hat. Unter den Zwangsarbeiter*innen befanden sich auch viele queere Menschen, die nicht selten auch ihren Tod in den Arbeitslagern gefunden haben.
Das Schweigen danach
Die allgemeine Aufarbeitung der NS-Vergangenheit gewisser Firmen beziehungsweise ihrer Rechtsnachfolger verlief nach 1945 sehr lückenhaft. Eine Beteiligung an der Erhaltung des menschenfeindlichen Regimes wurde meist abgetan, Dokumentationen eventueller großer Parteispenden an die NSDAP geschwärzt. Es darf bei allen Pride Kollektionen, Einfärben der Social Media Profile in Regenbogenfarben und Spenden an queere Projekte nicht vergessen werden – viele dieser Konzerne haben in der Vergangenheit mit ganz anderen Menschen zusammengearbeitet.
Natürlich haben viele Unternehmen eine unrühmliche NS-Vergangenheit und sehen die Rechte von queeren Menschen heute als „wichtigen Teil der Firmenphilosophie“. Zum Glück. Unternehmen ständig auf das zu reduzieren, was sie zwischen 1933 bis 1945 getan und wen sie unterstützt haben, wäre natürlich unfair. Aber! Es geht auch um die Zeit nach dem NS-Regime. Um die Aufarbeitung der Vergangenheit beziehungsweise die Nicht-Aufarbeitung. Um das ohrenbetäubende Schweigen, als es darum ging, wie sie das System aufrechterhielten und auch selbst davon profitierten. Als es um eine Zeit ging, in der sie Jüd*innen, Roma & Sinti, sogenannte „Asoziale“ und queere Menschen für sie kostenlos als Zwangsarbeiter*innen beschäftigten. Bei aller Unterstützung und Solidarität mit der queeren Community scheint das ehrliche und konsequente Aufarbeiten der eigenen Vergangenheit keine hohe Priorität zu sein.
Selektive Solidarität
Heute geben sich viele der betroffenen Firmen queerfreundlich. Das ist zunächst eine positive Entwicklung. Doch zwischen Symbolik und Substanz klafft oft eine Lücke. Das Schweigen ist teilweise bis heute noch präsent. Adidas zum Beispiel tritt in Europa schon seit einiger Zeit mit Regenbogen-Produkten und großen Kampagnen auf. 2018 war Adidas Sponsor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland – einem Land mit einer extrem restriktiven Gesetzeslage in Bezug auf queere Rechte. Ein anderes bekanntes Beispiel ist Amazon. Im Pride Month wirbt der Konzern mit einer großen Palette an Regenbogenartikel – besonders in den USA unterstützt Amazon politische Aktionskomitees, die sich gegen trans Menschen und nicht-binäre Menschen einsetzen.
Unternehmen wie BMW, Mercedes oder Nestlé färben im Juni ihre Social Media Profile schön in Regenbogenfarben ein, um ihre Solidarität zu bekunden. Aber oft nur in europäischen oder nordamerikanischen Staaten. In Ländern wie Saudi-Arabien oder Russland verzichtet man lieber auf diese Solidaritätsbekundung. Solidarität mit der queeren Community hört offenbar bei bestimmten Staatsgrenzen auf. Schweigen besteht bis heute, nur oft in anderen Teilen der Welt.
Pride sind wir
Über die Jahre bildete sich eine starke Erinnerungskultur. Rosa-Winkel-Gedenksteine, Stolpersteine, queere Gedenkinitiativen, NGOs und Vereine sorgen dafür, dass Geschichten queerer Menschen im Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten. Menschen auf der ganzen Welt engagieren sich für die queere Community – damals wie heute.
Pride ist nicht die Schaufensterdeko multinationaler Konzerne. Pride sind nicht die Unternehmen, die einmal im Jahr eine Regenbogenkollektion in ihren Auslagen anbieten. Ihre finanzielle und öffentlichkeitswirksame Unterstützung bei Aufklärungsprojekten und Pride-Paraden heute ist richtig und wichtig. Trotzdem sind Konzerne nicht das Herz und die Seele der queeren Bewegung. Wirtschaftlich orientierte Akteure sind nicht Pride.
Pride sind wir. Die, die auf Pride-Paraden Farbe bekennen. Die, die jeden Tag mit Menschen über queere Rechte diskutieren. Die, die aufklären und bilden in Schulen, Unternehmen und sozialen Einrichtungen. Und besonders auch die, die in Ländern wissentlich eine Verhaftung in Kauf nehmen, wenn sie für queere Sichtbarkeit demonstrieren. Wir können heute am Beispiel der USA beobachten, wie Queerfreundlichkeit und Diversität großer Konzerne unter politischem Druck oder unter wirtschaftlichen Abwägungen schwinden. Aber wir, die Menschen, werden immer da sein, um die Regenbogenflagge zu hissen.
Text von Sebastian Brandstätter und Florian Niederseer